LTB 576: Rezension
In diesem Artikel wird das LTB 576 rezensiert. Ob dieser Band tolles Top, ein fataler Flop oder einfach nur müdes Mittelmaß ist, erfährst du hier. Dranbleiben ;-) Einen neutralen enzyklopädischen Artikel findest du unter LTB 576.
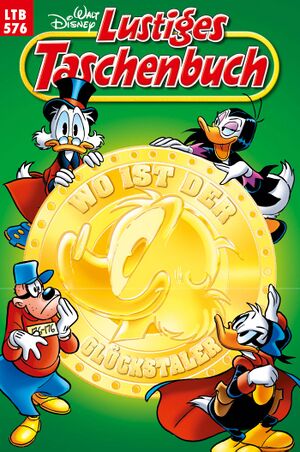
Jeder kann hier seine persönliche Meinung zu den in LTB 576 erschienenen Geschichten verfassen. Eine Unterschrift unter jedem Kommentar ist erwünscht (einzufügen mit ~~~~). Die Geschichten können mit Highlight ![]() , Gut
, Gut ![]() , Mittelmaß
, Mittelmaß ![]() oder Schlecht
oder Schlecht ![]() bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!
bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!
Cover
Auch wenn der Inhalt schwankend war, die Cover der LTBs dieses Jahr waren allesamt doch recht schön anzusehen, einige wie das Gervasio-Cover letzten Monat stachen sogar besonders hervor. Dieses hier ist leider ziemlich schwach, zumindest mich spricht es gar nicht an: Sei es der komische grüne Hintergrund, die Münze in der Mitte mit der blassgoldenen Schrift, die den Titel ziemlich unleserlich macht (gold auf gold, wer kam auf die Idee?) oder die nicht besonders ansehnlichen Figuren, die wie ausgeschnitten und eingefügt aussehen und allesamt eher seltsame Gesichtsausdrücke haben - sei es der ratlose Dagobert, die siegessicher Gundel Gaukeley, der grimmige Phantomias oder der verwirrte Panzerknacker. Kein wirklich schönes Cover, wird wohl kaum jemanden zum Gelegenheitskauf verführen. Außerdem: Ich dachte eigentlich, mittelwelle hätte sich endgültig die Bezeichnung Glückszehner für Dagoberts erste selbstverdiente Münze durchgesetzt. Hier ist es nun doch plötzlich wieder der Glückstaler. Hm. Ob der Inhalt mehr überzeugen kann? Mittelmäßig-. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Das Cover ist wenig aussagekräftig. Den Charakteren mit ganz unterschiedlichen Gesichtsausdrücken fehlt der gemeinsame Nenner, weswegen die Zeichnungen wie zufällig ausgewählt wirken und keinen Eindruck hinterlassen können. Auch der schlichte, grüne Hintergrund sowie der einfarbige Glückszehner sind optisch nicht sonderlich ansehnlich. Schwach Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)
Wo ist der Glückstaler?
- Story: Maya Åstrup
- Zeichnungen: Andrea Freccero
- Seiten: 25
Es ist Nacht in Entenhausen und Dagobert außer Haus. Ideale Bedingungen für die Panzerknacker also, den Geldspeicher auszurauben. In einem ersten erfolglosen Versuch fällt ihnen allerdings lediglich Dagoberts erste selbstverdiente Münze in die Hände. Ihren Wert nicht erkennend werfen sie ihn achtlos weg und machen sich erneut ans Werk. Als Phantomias die Gauner am Tatort stellt, ist der Glücktaler bereits unbemerkt unterwegs auf einer abenteuerlichen Reise, die ihn von Hand zu Hand wandern lässt. Wird er am Ende dieser ereignisreichen Nacht seinen Weg zurück zum Speicher finden?
Trotz Titel wird Dagoberts erste selbstverdiente Münze doch wieder als Zehner bezeichnet... Was soll dann der Quatsch mit "Glückstaler"? Aber das ist natürlich nur Jammern über Kleinigkeiten - die eigentliche Geschichte krankt dann doch an ganz anderen Stellen. Maya Åstrup gehört für mein Dafürhalten zu den besseren Egmont-AutorInnen, diese Geschichte überzeugt mich in keinster Weise. Die Idee, den Glückszehner auf eine ungreiwillige Reise zu schicken und dabei von Figur zu Figur wandern zu lassen, ist zwar nicht neu oder übermäßig originell, aber dennoch eigentlich eine interessante Grundidee. Eigentlich - denn das wird hier schlechtsmöglichst umgesetzt. Alle Storyelemente hier wirken wie lustlos durcheinandergewürfelt und ergeben wenig Sinn. Die Panzerknacker greifen mit magischen Waffen den Speicher an, Phantomias will eingreifen, ein Polizist und eine Polizistin erleben eine Reifenpanne (inklusive ultranervigen "Wer hat heutzutage noch Bargeld dabei"-Running Gag), Dussel verteilt als Tankwart Naschereien... Nicht wirklich witzig. Der Plot um Gundel und den Golem wird inhaltlich nicht mal wirklich mit dem Rest verknüpft. Schade, Frecceros Zeichnungen überzeugen nicht zuletzt dank einer gelungenen Kolerierung, aber retten kann das diesen Murks an Titelgeschichte nicht. Schlecht. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Der Prolog, welcher die besondere Bedeutung des Glückszehners für den reichsten Erpel der Welt in liebevollen Szenen herausstellt und die Frage aufwirft, ob hinter dieser gewöhnlichen Münze nicht doch mehr steckt als ein sentimentales Kleinod, bevor eine Explosion im Splashpanel-Format die einleitende Szene abrupt beendet, gibt die generelle Stimmung vor, in der diese Hommage an den Glückszehner gelesen werden soll. Man muss die aufgeworfene Frage mit „Ja“ beantworten und akzeptieren, dass er über einen Funken Eigenwille besitzt, der es ihm ermöglicht, das Geschehen zu beeinflussen. Tut man dies nicht, so besteht die Geschichte nur aus einem Ablauf von grob verbundenen Einzelereignissen. Lässt man sich jedoch auf die sentimentale Stimmung ein, so entfaltet sich ein atmosphärisches Abenteuer, in dem es dem Glückszehner auf seiner Wanderung von Hand zu Hand gelingt, durch seine Anwesenheit die jeweilige Szene derart zu beeinflussen, dass in Summe nicht nur der Überfall der Panzerknacker verhindert wird, sondern er selbst den Weg zurück zu seinem Besitzer findet. Daher gefiel mir gerade die Banalität der Handlungen so sehr, selbst wenn der Running Gag vom aus der Mode gekommenen Bargeld nervend überstrapaziert wird und die Umstände manchmal dem Plotfortschritt zu zweckdienlich sind. Letzteres ist jedoch verschmerzbar, weil die Geschichte, wie bereits erwähnt, weniger von einem spannenden Geschehen, als vielmehr ihrer Atmosphäre lebt. Hierzu trägt Freccero einen großen Anteil bei. Sein gewohnt dynamischer Zeichenstil im Verbindung mit einer äußerst ausdrucksstarken Figurendarstellung mit vielen interessanten Details lässt die Handlung lebendig werden, während ruhige Panels ohne oder kaum Text unterstützt von einer hervorragenden Kolorierung, welche die Stimmung einer verregneten Nacht toll einfängt, die dichte Atmosphäre sicherstellen. Der für die Geschichte nebensächliche, aber herzerwärmende Epilog um das Schicksal des Golems lässt den Leser schließlich mit einem wohligen Gefühl zurück und rundet diese atmosphärische, interessant aufgebaute Hommage an Dagoberts erste selbstverdiente Münze ab. Gut+ Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)
Die Geheimzutat
- Story: Simona Grandi
- Zeichnungen: Sandro Del Conte
- Seiten: 17
Der Absatz von Dagoberts Backwaren fällt ins Bodenlose, weil die Kunden mit deren Qualität nicht zufrieden sind. Er holt sich Rat bei Oma Duck, die ihm freudig zeigt, welche Zutaten es für ein gutes Produkt benötigt.
Eine belanglose Kurzgeschichte über Dagobert und Dorette folgt hier. Letztere lehrt den Großkapitalisten die Vorzüge von Bio-Lebensmittelherstellung und verknüpft das Ganze mit einem netten, aber unspektakulären Rückblick in dir Kindheit der leidenschaftichen Landwirtin. Die Moral der Geschichte wird dem Leser direkt und ungefiltert aufgedrückt, gelungene Gags oder spannende Handlungselemente sucht man vergebens. Sandro Del Contes Zeichnungen tragen zumindest bei mir auch nicht gerade zur Begeisterung bei. Ein schnell gelesener Lückenfüller. Mittelmäßig. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Kitschiger als hier kann man eine Idealvorstellung der Landwirtschaft wohl kaum darstellen. Egal welchen Aspekt des Hoflebens Oma Duck Dagobert zeigt, vor lauter Rührung und auf die Nase gedrückter Wohlfühlatmosphäre werden Dagoberts Anmerkungen sowie eigene industrielle Produkte unmittelbar als intolerable abgetan. Höhepunkt davon ist der besondere Geschmack der Hofeigenen Äpfel, deren Vanillenote daher stammt, dass Dorette in ihrer Kindheit, als der Hof und die gesamte Apfelplantage von einem Sturm zerstört wurden, eine Vanilleschote neben einem Apfel verbuddelt hat, der als Grundstein der neuen Apfelbäume diente. Angesichts dieser monotonen Ausrichtung kann man natürlich keine Wendungen oder andere erzählerische Kniffe erwarten, die dem Lückenfüller etwas inhaltlichen Gehalt verliehen hätte. Die zeichnerische Umsetzung hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Einerseits harmonieren die gelungen Tier- und Hofdarstellung sehr gut, andererseits fallen die Charakterdarstellungen dagegen ab. Insbesondere die starren Blicke wirken verstörend. Vielleicht haben sie aber auch einfach nur diese vor Kitsch triefende Geschichte gelesen. Schlecht-
Völlig verschachtelt
- Story: Sio
- Zeichnungen: Nico Picone, Stefano Intini
- Seiten: 52
Donald und Dagobert treffen sich in einem merkwürdigen Raum, in den beide durch eine Verbindung zu ihrer Wohnung gelangt sind (bei Donald ist es die Dusche). Später kommen noch Gundel und Minnie (via Backofen) hinzu. Weitere Figuren folgen mit der Zeit und über seltsamere Wege. Mit dabei ist eine merkwürdige Schachtel, die nicht geöffnet werden soll.
Autor Sio ist für seinen ausgefallenen Humor und seine ungewöhnliche Erzählweise bekannt. Leider überspannt er für meinen Geschmack den Bogen hier aber völlig. Ähnlich wie bei der Titelgeschichte ist die Grundidee dieser ungewöhnlich verschachtelten Schachtelgeschichte eigentlich eine recht reizvolle: Immer mehr Entenhausener sowohl aus dem Duck- als auch dem Maus-Universum treffen in einem geheimnisvollen Raum aufeinander und versuchen herauszufinden, was genau passiert ist. Dadurch ergeben sich auch ein paar außergewöhnliche Figurenkonstellationen wie Minnie und Gundel, oder auch dass Trudi ohne ihr Katerchen direkt mit den Ducks interagiert ist eher ungewöhnlich. Hier ergäbe sich in der Theorie das Potenzial für einige gelungene Gags, leider zünden die hier dargebotenen Gags nicht wirklich. Für mich wirkt es eher, als würde Sio versuchen, so viel Nonsens wie möglich in die Geschichte stopfen zu wollen, ohne einen Wert darauf zu legen, ob das Ergebnis dann überhaupt noch lustig und pointiert oder nur noch nervig und unlogisch rüberkommt. In meinen Augen ist leider letzteres der Fall... Zudem verlieren die ungewöhnlichen Figurenkonstellation auch dadurch seinen Reiz, dass sich fast alle Figuren gleich verhalten - nämlich strunzdämlich. Man kennt es zwar auch von beispielsweise Enrico Faccini oder Silvia Ziche, dass Figuren sich für eine abgedrehte Gagstory mal etwas merkwürdiger als sonst verhalten, hier wird mir die Intelligenz einiger Figuren aber zu sehr reduziert. Von Dussel mag man eine zur Dummheit neigende Naivität noch erwarten und auch Donald ist an sich nicht die hellste Kerze auf dem Leuchter, aber dass Minnie derart planlos und dümmlich agiert oder dass Trudi sich bereitwillig selbst als alte Schachtel beleidigt ist etwas viel des Guten. Nicht von der allgemeinen Blödheit betroffen scheinen nur Dsgobert und Gundel zu sein, die dafür aber umso fieser auftreten. Kein einziger Charakter kann hier bei mir Sympathiepunkte sammeln. Gelungen finde ich nur die kleine, feine Rolle Mickys, die seine übliche Position als Held des Tages gelungen karrikiert und untergräbt. Das Ende ist dann wieder enttäuschend und erstaunlich unlustig. Zudem kommt noch, dass mir der Stil von Nico Picone, der den Großteil der Geschichte umsetzt, so gar nicht zusagt. Schlecht. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
An und für sich möchte ich den Ansatz der Geschichte mögen, aber je länger sie wurde, desto mehr verlor ich das Interesse. Auf der Plus-Seite steht vor allem ein vielfach gelungener Nonsense-Dialoghumor mit einigen umwerfend schwachsinnigen Aussagen, auch wenn die Figuren dabei teils ungewohnt stark von ihrer typischen Persönlichkeit abweichen und mancher Charakter, wie Trudi, kaum in Erscheinung tritt. Andererseits wird die Auseinandersetzung mit der Schachtel als Rahmenhandlung zu sehr in die Länge gezogen, während neue Handlungsimpulse auf der Strecke bleiben, sodass die Aufmerksamkeit des Lesers immer weiter nachlässt. Dieser Trend setzt sich leider bis zum für die Prämisse unpassend banal auflösenden Ende fort. Weiterhin fiel mir die Diskrepanz zwischen den Zeichnungen von Stefano Intini und Nico Picone negativ auf. So gelingt es Intini, verantwortlich für die ersten acht sowie letzten sechzehn Seiten, wesentlich besser, dem abstrusen Handeln Leben einzuhauchen, wohingegen Picones Figuren eher steif und reduziert in ihrer Ausdrucksfähigkeit wirken, ganz unabhängig von ihren unstimmigen Proportionen. Mittelmäßig- Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)
Erpel gegen Ganter
- Story: Roberto Gagnor
- Zeichnungen: Paolo De Lorenzi
- Seiten: 24
Primus von Quack wird vom Bürgermeister um Hilfe geben, denn im Eintrachtviertel tobt ein erbitterter Kampf zwischen zwei Jugendgangs, die um die Vorherrschaft im Viertel und das konsequent hälftig genutzte Kulturzentrum streiten. Obwohl Primus nicht ganz in die aufgeheizte Situation passen mag, gelingt es ihm, diese zu befrieden, indem er auch noch mit detektivischem Spürsinn die Ursache für den Streit ausfindig machen kann und dabei auf Umwegen das Vertrauen beider Gangs gewinnt.
Endlich: eine wirklich gelungene und unterhaltsame Geschichte! Mit Primus von Quack darf hier mal wieder eine eher seltene Hauptfigur ran, tatsächlich zeigt sich der ewige Theoretiker hier mal erstaunlich proaktiv, dennoch passt die Rolle hier sehr schön: Der intellektuelle Greis vermittelt in der Jugendszene. Zwar finde ich die Jugendsprache hier zwar anstrengend gekünstelt und aufgesetzt (ich kann da natürlich nur für die Übersetzung sprechen, da ich das italienische Original nicht kenne), ansonsten ist die Jugendkultur mit Rap und Grafitti recht schön eingefangen. Es sorgt auch für einige gelungene Gags in der Interaktion zwischen Primus und den Jugendgangs, am witzigsten finde ich, wie der Professor ein Rapbattle auf Latein bestreitet. Auch der Kriminalfall ist recht spannend ausgearbeitet, das Ende erstaunlich versöhnlich und mit einer kleinen Moral - die aber längst nicht so unverschämt daherkommt wie bei der "Geheimzutat". De Lorenzis Zeichnungen sind eher unauffällig, aber solide. Gut. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Eine interessante Thematik mit einigen nett aufgebauten kulturellen Bezügen, die in eine solide aufgebaute Geschichte integriert werden, deren Spannungsaufbau allerdings unterentwickelt bleibt. Die Bedeutungsschwere hätte von einem Begleiter für Primus profitiert, da so eine anschaulichere Reflexion der Handlung mittels Dialogen zwischen diesen beiden möglich gewesen wäre. Auch wäre der Professor charakterlich nicht derart blass geblieben. Mittelmäßig Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)
Eine folgenschwere Entscheidung
- Story: Alessandro Mainardi
- Zeichnungen: Nico Picone
- Seiten: 12
Dagobert und Donald haben eine Besprechung, dabei hören Baptist und Fräulein Rührig, dass Dagobert einen von beiden entlassen will. Fortan versuchen die beiden so viele Fehler wie möglich zu machen, damit Dagobert sie selber, und nicht den Arbeitskollegen, entlässt.
Anders als Dagoberts hier ungewöhnlich begriffsstutzig agierenden Angestellten ist dem geneigten Leser natürlich gleich klar, worauf die Geschichte hinauslaufen wird und dass Dagobert natürlich gar nicht vorhat, einen der beiden zu entlassen. So dümpelt die Geschichte aufgrund der mehr als vorhersehbaren Pointe trotz ihrer beschränkten Seitenzahl vor sich hin und ist insgesamt eher langweilig als witzig. Denn auch die Versuche der beiden, die eigene Arbeit zu sabotieren, sind nur mäßig lustig oder kreativ. Das rührseelige Ende ist mir persönlich auch etwas zu dick aufgetragen. Mittelmäßig. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Auf einem abwegigen Missverständnis beruhender, vernachlässigbarer Lückenfüller mit platten Gags und hässlich deformierten Figuren. Schwach Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)
Der Fluktomat
- Story: Rudy Salvagnini
- Zeichnungen: Marco Palazzi
- Farben: Chiara Bonacini
- Seiten: 26
Micky wird ins Gefängnis zum dort einsitzenden Doktor Minchhusen gerufen. Dessen Zellengenosse war bis zu seiner Entlassung Kater Karlo. Nun aber behauptet Doktor Aster, er sei in Wirklichkeit Kater Karlo, und Doktor Aster habe dafür gesorgt, dass die beiden ihre Körper getauscht haben. Nun soll Micky also den Justizirrtum vermeiden – wenn die Geschichte stimmt, wofür es Indizien gibt. Oder ist das alles nur ein perfider Plan?
Aufgrund des völlig verschachtelten Crossovers enthält der Band nur eine einzige reine Maus-Geschichte. Leider ist diese eher enttäuschend. Zwar beginnt sie doch recht vielversprechend mit dem vermeintlichen Körpertausch und einigen Querverweisen auf Geschichten u.a. von Romano Scarpa. Leider wird es mir ab dann doch leider zu konfus und undurchsichtig. Ich durchschaue weder Minchhusens Plan noch die Partnerschaft mit Karlo so ganz. Auch dass Micky von Anfang an alles durchschaut, wirkt eher unglaubwürdig und macht die ganze Handlung ziemlich langweilig. Mal ganz abgesehen vom eher unlustigen Auftritt der Höhlenmäuse. Bonacinis Zeichnungen mögen mir auch nicht so gefallen. Mittelmäßig Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Diese Story zeigt, was passiert, wenn die Idee des Körpertausches aus Phantom-Saga: Albtraum auf der Koralleninsel dem letzten LTB in einer herkömmlichen MM-Detektivgeschichte umgesetzt wird. Der hohe erklärende Dialoganteil wird zwar durch einen vielfältigen Seitenaufbau aufgelockert, bleibt dennoch zäh, da emotionale Reaktionen auf das Gesagte kaum fokussiert werden. Weiterhin enttäuscht der weitere Verlauf des Falles angesichts dieser langwierigen Einleitung mit einer seltsamen, kurzen Holografie-Einlage und banaler Auflösung. Dem Autor war scheinbar die Vorstellung des Körpertausch-Konzeptes wichtiger als die Erzählung eines mitreißenden Mysteriums. Mittelmäßig Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)
Die Liste des Unfugs
- Story: Giorgio Fontana
- Zeichnungen: Luca Usai
- Farben: Barbara Casiraghi
- Seiten: 20
Donald ist von Dussel so genervt, dass er ihm – ähnlich wie bei seiner Schuldenliste bei Onkel Dagobert – eine Liste der Schäden präsentiert, die Dussel angerichtet hat. Dussel soll das abarbeiten.
Die Grundidee mit der Liste ist allerdings nur ein Aufhänger, um möglichst viel Dussel-Blödsinn auf 20 Seiten unterzubringen. Einen wirklichen roten Faden gibt es nicht. Dussel stellt sich so blöd an wie eh und je. Dabei ist er hier auch noch besonders uneinsichtig und hartnäckig, wodurch er keinerlei Sympathiepunkte bei mir sammeln kann. Im Gegenteil, ich kann Donalds Ärger hier gut nachvollziehen. Der arme Donald kann einem leidtun, besonders zum Ende hin. Lediglich Luca Usais Zeichnungen gefallen mir hier besonders gut, obwohl ich mit seinem Stil sonst nicht viel anfangen kann. Mittelmäßig. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Die Geschichte wählt eine alternative Herangehensweise an die Donald-Dussel-Dynamik, indem nicht die üblichen Kapriolen im Mittelpunkt stehen. Vielmehr wird versucht zu ergründen, warum Donald sich jedes Mal wieder an den Unternehmungen seines Vetters trotz all des Ärgers beteiligt. Im Gegensatz zu früheren Werken hat es der Autor Giorgio Fontana allerdings diesmal nicht geschafft, die psychologische Analyse von Figuren in eine unterhaltsame Geschichte einzubinden. Hierfür ist hauptsächlich der erörternde Aufbau verantwortlich, der die Geschichte zu einer Abfolge von schablonenhaften Versatzstücken macht. So wird anfangs die Art von Unternehmungen anhand kurzer im Dialog vorgestellten Beispiele dargestellt, um anschließend die negativen Auswirkungen auf Donald zu benennen, ebenfalls mündlich mittels kurzer Beispiele. Warum sich die darauf begründende Forderung nach Entschädigung durch Dussel weder material noch durch Arbeitsleistungen umsetzen lässt, wird daraufhin anhand seine Unfähigkeit verdeutlichende Versuche erläutert, worauf die Erkenntnis der Aussichtslosigkeit seitens Donald, etwas positives aus den Unternehmungen zu gewinnen, die Schlussfolgerung bildet, dass nicht der persönliche Vorteil Ursache für Donalds Unterstützung seines Vetters ist. Hieraufhin wird nun mithilfe Dusels neuester Idee, welche in Form seiner Clown-Verkleidung über den Storyverlauf hinweg wiederholt angedeutet wird und als verbindendes Element den Leser bei Laune halten soll, der tatsächliche Grund, Donalds ausgeprägte Neugier sowie Abenteuerlustigkeit, benannt. Genauso trocken wie diese Analyse liest sich leider auch die Geschichte, weil zum einen die zahlreichen aufgeführten Beispiele weder an sich kreativ sind noch lang genug in Erscheinung treten, um Eindruck zu hinterlassen, zum anderen man der biederen Gesprächsführung ihre Funktionalität ansieht. Des Weiteren bietet die klare Struktur keinen Raum für Auflockerungen abseits der Argumentationsführung. Deswegen ist es besonders enttäuschend, dass die Art, wie die Neugier als eigentliche Ursache vorgestellt wird, so lieblos ausfällt. Sie wird allzu offensichtlich angedeutet sowie im Gespräch nochmals klar benannt und führt schließlich zu einem inhaltlich schwachen, überholten Schlussgag. Ein Wegfallen der finalen Seite, in der offenbart wird, was sich hinter Dussels Kostüm verbirgt, hätte ein offenes Ende nach sich gezogen, welches stimmig zur Schlussfolgerung die Neugier und damit den analytischen Teil der Geschichte betont hätte. Insgesamt fällt der Ansatz der Geschichte einfach zu verkopft aus. Zum Fazit, dass nicht persönliche Bereicherung maßgeblich ist, sondern eine intrinsische Abenteuerlust, hätte eine deutlich straffere Argumentation ohne x-beliebige Beispiele ebenfalls geführt, zumal die eigentliche Fragestellung nach Donalds persönlichem Motiv meiner Meinung nach von geringem Interesse ist, stehen doch in der Kombi Donald-Dussel die eigentlichen, abgefahrenen Ideen sowie die Interaktionen im Vordergrund. Schwach Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)
Ohne Worte: Geschmiegelt und gestriegelt
- Story: Davide Aicardi
- Zeichnungen: Giulia Lomurno
- Farben: Gaetano Gabriele d'Aprile
- Seiten: 12
Der Oberstwaldmeister freut sich über eine Einladung zur Audienz beim Generalfeldmeister, und dafür muss er natürlich seine Galauniform aus dem Schrank hervorholen. Doch oh Schreck, ein Fleck – und ein wenig spack ist die Uniform auch noch! Oberstwaldmeister Guido Ganter kämpft mit allerlei Tücken und findet keine Worte – aber der Generalfeldmeister, und zwar die richtigen...
Mir gefallen solche "Ohne Worte"-Geschichten oft, da hier mal auf rein visuelle Gags statt auf Wortwitz gesetzt wird. Das ist hier gut gelungen und verleiht der Kurzgeschichte einen Charme, der mehr an klassische Cartoons als an moderne Comics erinnert. Klar ist die Geschichte arg albern, aber mich überzeugt der Slapstick-Humor, zumal man Guido Ganter selten in einer so zentralen Rolle erlebt - meist agiert er ja eher hinter den Kulissen des Fähnlein Fieselschweif. Der Schluss, in dem dann doch wieder gesprochen werden darf, überzeugt zudem durch eine wirklich gelungene Pointe, die auch leicht zum Nachdenken anregt. Die Zeichnungen sind solide und transportieren den Witz der Geschichte auch visuell vortrefflich. Gut. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Für eine auf Text verzichtende Geschichte überraschend gelungen mit ansprechenden Zeichnungen, welche die Mühen des Oberwaldmeisters liebevoll einfangen. Ein kleines Highlight ist zudem das vollseitige, atmosphärische Panel. Allerdings hat man die Geschichte aufgrund ihrer austauschbaren Handlung auch schnell wieder vergessen. Gut Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)
Schmuseweichgespült
- Story: Gabriele Mazzoleni
- Zeichnungen: Francesco D'Ippolito
- Genre: Superhelden
- Seiten: 23
Dussel sitzt im Kino neben dem Regisseur des Films, der wohl Quentin Tarantino nachempfunden ist. Aber der erkennt den Film nicht mehr wieder – die epische Schlacht am Ende wurde durch ein Match Schere-Stein-Papier ersetzt. Dussel befindet: Dies ist ein Fall für Flederduck. Bis der Superheld allerdings umgezogen am Tatort ist, ermittelt die Polizei schon, zumal ähnliche Vorkommnisse bekannt wurden. Das hält jedoch Flederduck nicht auf, der ebenfalls nach dem Schuldigen zu fahnden beginnt.
Dussel darf noch mal ran, diesmal in seiner Superheldenidentität als tollpatschig-naiver Flederduck. Diese Geschichte gefällt mir deutlich besser als die "Liste des Unfugs", da Dussel hier zwar ebenfalls für Chaos sorgt, er aber hier deutlich erkennbar nur die besten Absichten hat und tatsächlich zur Klärung des Falls beiträgt. Die taufe Polizistin, der Flederduck hier assistieren darf, ist ein unterhaltsamer neuer Charakter und trägt zur Komik der Geschichte bei. Das Motiv und der Plan des Bösewichts, dem "Schmusemann", ist recht hanebüchen und überdreht, aber sowas erwartet man ja bei einer Superheldenparodie mit Dussel in der Hauptrolle. Mit D'Ippolitos recht eigenartigem Stil werde ich mich wahrscheinlich nie wirklich anfreunden können, zu einer abgedrehten Flederduck-Geschichte passen seine Zeichnungen aber allemal. Gut. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Wer Dussel in seiner alternativen Identität als chaotischere Version von Phantomias etwas abgewinnen kann, dürfte mit dieser Superheldengeschichte zufrieden sein. Der Ablauf folgt zwar in meinen Augen etwas zu steif dem typischen Muster und bietet keine Überraschungen, aber die einzelnen Handlungselemente passen stimmig zu solch einem Klamauk lastigen Abenteuer. Angefangen mit der absurden Fähigkeit des Antagonisten über Flederducks sympathische Begleiterin, die sowohl durch flotte Sprüche ein wichtiger Teil des Dialoghumors ist sowie aufgrund ihres zielgerichteten Vorgehensweise den Plot stetig voranbringt, bis hin zur Art, wie der Fall gelöst wird, entwickelt sich eine unterhaltsame Geschichte, die ausreichend Platz für schräge Einlagen bietet, auch wenn diese hin und wieder den Erzählfluss nervend unterbrechen. Der schnelle Gag steht für mich etwas zu sehr im Mittelpunkt der Geschichte, was zusammen mit meiner leichten Abneigung gegenüber dem Superheld vs. Superbösewicht-Settings mich die Geschichte nicht so genießen lässt, wie sie es verdient hätte. Mittelmäßig+ Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)
Wortgefechte
- Story: Tito Faraci
- Zeichnungen: Andrea Lucci
- Seiten: 6
Phantomias liefert sich ein öffentliches Wortgefecht mit einem Schurken, bei dem beide den Faden verlieren.
Eine Superheldengeschichte im Band reicht wohl nicht aus, da wohl auf Biegen und Brechen eine Phantomias-Geschichte her muss - und sei es nur wie hier ein Lückenfüller von gerade mal sechs Seiten. Tito Faraci versucht hier offenkundig, die teils schwülstigen Dialoge des Superhelden-Genres zu persiflieren. Das gelingt nur mäßig, die Dialoge zwischen Phantomias und dem Superschurken geraten eher hölzern als unterhaltsam. Natürlich kann ich hier wieder nicht sagen, ob es an der Übersetzung liegt oder der Originaltext ähnlich uninspiriert rüberkommt wie im Deutschen. Der Schlussgag ist schon ab Seite 1 vorhersehbar. Luccis Zeichnungen sind okay, die Handlung aber sehr belanglos. Schade, Faraci hat normalerweise großes Potenzial, dass er aber auf 6 Seiten wohl nicht wirklich entfalten kann. Mittelmäßig-. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Ist die Ausgangslage der Wortgefechte bereits altbacken, fällt die Pointe der fehlenden Schlagfertigkeit ebenso uninspiriert aus. Leider sucht man ebenso gewitzte Wortspiele vergeblich. Schlecht Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)
Die Chaosblase
- Story: Federico Rossi Edrighi
- Zeichnungen: Stefano Intini
- Seiten: 30
Daniel Düsentrieb baut das perfekte Hexenabwehrsystem, einen Wahrscheinlichkeitsannullator, der dafür sorgen soll, dass die Realität nicht änderbar ist (auch nicht durch Zaubersprüche). Gundel Gaukeley hat das allerdings mitbekommen und versucht, das Gerät vor dem Einsatz unschädlich zu machen. Das misslingt allerdings gehörig, denn als Gundels Zauber auf das Gerät trifft, bricht das pure Chaos aus – es entsteht eine Blase, in der Helferlein und Nimmermehr gefangen sind, während Daniel und Gundel draußen sind. Sie verbünden sich und landen in einer irren, sich ändernden Realität.
Gundel tritt in diesem Band bereits zum dritten Mal auf. Bekamen die Geschichten mit hexischer Beteiligung bei mir bisher jeweils die Bewertung "schlecht", überzeugt diese hier mehr und ist definitiv die beste Gundel-Geschichte dieser Ausgabe. Die Kombination Gundel/Düsentrieb gab es im LTB tatsächlich schon ein paar Mal - z.B. in Eine harte Prüfung aus LTB 397 oder Kampf um den Super-Max-Verstärker aus LTB 428. Der Kontrast zwischen Hexe und Erfinder liefert aber eben auch einen gewissen Reiz, den verschiedene Autorinnen und Autoren wohl zu nutzen wissen. Diese Geschichte liefert doch einige originelle Einfälle, indem der Autor mit der irren verdrehten Realität innerhalb der titelgebenden Chaos-Blase spielt. Dass Düsi und Gundel - eigentlich ja Feinde, da Düsentrieb sich seinerseits für Dagobert Ducks technische Hexenabwehr verantwortlich zeigt, sich verbünden, um ihre besten Freunde Helferlein und Nimmermehr zu retten, ist ein schöner und rührender Aufhänger. Nicht nur inhaltlich, auch zeichnerisch kann die Realität innerhalb der Blase vollends überzeugen. Stefano Intini darf sich hier voll austoben, sein dynamischer Stil kommt hier voll zur Geltung. Ein wirklich gelungener Abschluss eines wenig gelungenen Bandes. Gut. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Die routinierte, in erwartbaren Bahnen verlaufende Geschichte schafft einen stimmigen Rahmen für die humorvollen Einfälle, die durch Intinis schroffe Zeichnungen gelungen umgesetzt werden. Besonders die starke Gestaltung von Nimmermehr verdient ein Lob. Die Paralleldimensionen werden teils für nette Gags genutzt, wie das Altern der Protagonisten, hätten aber mehrheitlich kreativer gestaltet werden können. Vor allem die Monsterwelt, durch die Nimmermehr und Helferlein wandern, nimmt für ihre grobe, uninteressante Ausarbeitung zu viel Platz ein und verlangsamt den Erzählfluss spürbar. Ab dem Mittelteil flacht die Geschichte mit dem Wechsel von einer Komikzentrierten hin zu einer dramatischen Erzählweise ab. Obwohl die emotionale Note durchaus gefühlvoll vermittelt wird, nimmt der plötzliche Humorverzicht der Geschichte den bis dahin vorherrschenden Schwung. Mittelmäßig Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)
Fazit
Der letzte Band stellte mit gleich drei Highlights einen Höhepunkt dieses LTB-Jahres dar. Scheinbar muss das redaktionell ausgeglichen werden, denn hier präsentiert sich uns nun der für mein Dafürhalten bisherige Tiefpunkt 2023. Zwar enthält der Band auch einige recht unterhaltsame und lesenswerte Geschichten, jedoch kein echtes Highlight, das man unbedingt gelesen haben muss. Außerdem sind sowohl die Titelgeschichte als auch die von Sio verzapfte mit Abstand längste Geschichte des Bandes ziemliche Flops, die zumindest mir gar keinen Spaß gemacht hat. Der Rest des Bandes besteht vor allem aus belanglosem Kleinstkram sowie einem eher langweiligen Maus-Krimi. Das eher unansehnliche Cover sollte zurecht Gelegenheitsleser abschrecken können. Denn empfehlenswert ist der Band nicht. Hoffen wir, dass es in den letzten Monaten des Jahres wieder etwas bergauf geht. Mittelmäßig. Professor von Quack (Diskussion) 00:53, 1. Okt. 2023 (CEST)
Das LTB hat mir mit Ausnahme der Titelgeschichte kaum Freude bereitet. Absurdes sowie Nonsense dominieren den Band derart stark, dass ein bodenständiger Kontrast anderer Geschichten fehlt, der mich diese abgedrehten Abenteuer aufgrund ihrer Andersartigkeit erst wertschätzen lässt. Irgendwann hat man sich an den Intinis, D'Ippolitos und Picones satt gesehen und auch der verrückteste Einfall lockt keine Reaktion mehr hervor. Wenn man das Taschenbuch am Stück liest, lässt die einseitige Zusammenstellung viele Geschichten schlechter wirken, als sie eigentlich sind. Weiterhin nimmt der Anteil an extrem kurzen Geschichten (vier von elf Geschichten unter 20 Seiten) einfach zu viel Platz ein und besitzt größtenteils Lückenfüllerqualitäten. Erinnerungswert sind neben der atmosphärischen Hommage an den Glückstaler von Åstrup und Freccero lediglich eine schöne Geschichte über die Mühen des Oberstwaldmeisters, seine Uniform zu reinigen, sowie der missglückte Versuch Fontanas, Donalds Beweggründe für sein Einlassen auf Dussels Ideen zu analysieren, aufgrund des psychologischen Ansatzes. Schwach Lagoon (Diskussion) 21:35, 8. Okt. 2023 (CEST)