LTB 71: Rezension

In diesem Artikel wird das LTB 71 rezensiert. Welche Geschichten erfreuen das Fan-Herz und welche sollte man dem Gemütszustand halber lieber weglassen? Das erfährst du hier! Einen neutralen enzyklopädischen Artikel findest du unter LTB 71.
Jeder kann hier seine persönliche Meinung zu den in LTB 71 erschienenen Geschichten verfassen. Eine Unterschrift unter jedem Kommentar ist erwünscht (einzufügen mit ~~~~). Die Geschichten können mit Highlight ![]() , Gut
, Gut ![]() , Mittelmaß
, Mittelmaß ![]() oder Schlecht
oder Schlecht ![]() bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!
bewertet werden. Bei der Bewertung sollten Zeichnungen, Plot und Übersetzungen mit einbezogen werden. Eine genaue Anleitung zum Verfassen einer Rezension findest du hier. Viel Spaß!
Cover[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
![]() Der Multimilliardär Dagobert Duck sitzt, die Linke in die Hüfte gestützt, auf einem Münzhaufen, in den sich auch ein einziges Bündel Banknoten verirrt hat. Den Großteil des Motivs macht jedoch der Hintergrund aus, der einen das vorgegebene Diagramm nach oben sprengenden Börsenchart zeigt, vermutlich die Gewinnentwicklung der Duckschen Unternehmen darstellend. Wie zum Hohn ist der Hintergrund in einem an die Telekom-Aktien erinnernden Magenta-Ton gehalten. Aber davon konnte man im Jahr 1980 natürlich noch nichts wissen…
Der Multimilliardär Dagobert Duck sitzt, die Linke in die Hüfte gestützt, auf einem Münzhaufen, in den sich auch ein einziges Bündel Banknoten verirrt hat. Den Großteil des Motivs macht jedoch der Hintergrund aus, der einen das vorgegebene Diagramm nach oben sprengenden Börsenchart zeigt, vermutlich die Gewinnentwicklung der Duckschen Unternehmen darstellend. Wie zum Hohn ist der Hintergrund in einem an die Telekom-Aktien erinnernden Magenta-Ton gehalten. Aber davon konnte man im Jahr 1980 natürlich noch nichts wissen…
Je länger ich das Cover betrachte, desto schlechter wird es: Dagobert ist steif wie eine Puppe, sein Blick geht ins Nirgendwo, und sein Spazierstock bricht irgendwo auf halbem Wege ab. Im italienischen Original war das noch halbwegs durch den sich an diesem Platz befindlichen Schriftzug („Zio Paperone Maxi Manager“) zu rechtfertigen, der im LTB aber erst einen guten Zentimeter weiter oben beginnt. Schwacher Trost, dass immerhin mal aus dem Alltag börsennotierter Unternehmen berichtet wird. Giancarlo Gatti hat bessere Cover gezeichnet. Hobrowili (Diskussion) 11:21, 11. Mär. 2025 (CET)
Rahmengeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
![]() Es geht gleich weiter mit Giancarlo Gatti in der von ihm gezeichneten Rahmengeschichte. Die immerhin zum Titel passende Vorgeschichte zeigt Onkel Dagobert, wie er Anweisungen zur Neuordnung seiner Unternehmen erteilt. Die Sekretärin wird in der deutschen Übersetzung zwar „Fräulein Rührig“ genannt, ist jedoch offenbar eine andere Figur. Es folgen einige weitgehend sinnbefreite Übergänge von einer Geschichte in die andere. Eine der Geschichten aus dem italienischen Original-I Classici (Nr. 38 der Seconda Serie) war bereits vier Jahre vorher in einem Band der Donald Duck-Reihe veröffentlicht worden, sodass sie gegen eine andere („Onkel Dagobert und die Probe aufs Exempel“) ausgetauscht werden musste. Ungeschickterweise wurde auch die von Perego gezeichnete anschließende Zwischengeschichte mitverwendet, sodass alles gänzlich Kraut und Rüben wird. Hobrowili (Diskussion) 11:21, 11. Mär. 2025 (CET)
Es geht gleich weiter mit Giancarlo Gatti in der von ihm gezeichneten Rahmengeschichte. Die immerhin zum Titel passende Vorgeschichte zeigt Onkel Dagobert, wie er Anweisungen zur Neuordnung seiner Unternehmen erteilt. Die Sekretärin wird in der deutschen Übersetzung zwar „Fräulein Rührig“ genannt, ist jedoch offenbar eine andere Figur. Es folgen einige weitgehend sinnbefreite Übergänge von einer Geschichte in die andere. Eine der Geschichten aus dem italienischen Original-I Classici (Nr. 38 der Seconda Serie) war bereits vier Jahre vorher in einem Band der Donald Duck-Reihe veröffentlicht worden, sodass sie gegen eine andere („Onkel Dagobert und die Probe aufs Exempel“) ausgetauscht werden musste. Ungeschickterweise wurde auch die von Perego gezeichnete anschließende Zwischengeschichte mitverwendet, sodass alles gänzlich Kraut und Rüben wird. Hobrowili (Diskussion) 11:21, 11. Mär. 2025 (CET)
Onkel Dagobert und der starke Regen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
„Aaaah! Einfach herrlich! Hineinspringen… und wie ein Maulwurf darin herumwühlen… und treiben lassen wie auf einer Luftmatratze auf dem Wasser!“ (Dagobert variiert seine Lieblingssätze beim Baden im Gold)
![]() Onkel Dagobert will seine völlig zerknitterten Geldscheine mit Stärke behandeln, damit sie wieder ansehnlich werden. Doch während des Transports öffnet Donald durch Betätigung eines falsch verkabelten Knopfs die Ladeluke und die Stärke ergießt sich als Regen über die Landschaft. Dagobert und das Wachpersonal, das gerade die Taler in einen Lkw verladen, können sich daraufhin nicht mehr bewegen, während die Panzerknacker einen Schirm dabeihaben und sich nur noch zu bedienen brauchen. Zum Pech für sie nutzen sie zum Geldtransport dasselbe falsch verkabelte Flugzeug. Der betätigte Knopf aktiviert demnach auch bei ihnen nicht den Blitzableiter, sondern öffnet die Ladeluke. Donald und Tick, Trick und Track werden verdonnert, die Gegend abzugehen und die verstreuten Talersäcke aufzuklauben…
Onkel Dagobert will seine völlig zerknitterten Geldscheine mit Stärke behandeln, damit sie wieder ansehnlich werden. Doch während des Transports öffnet Donald durch Betätigung eines falsch verkabelten Knopfs die Ladeluke und die Stärke ergießt sich als Regen über die Landschaft. Dagobert und das Wachpersonal, das gerade die Taler in einen Lkw verladen, können sich daraufhin nicht mehr bewegen, während die Panzerknacker einen Schirm dabeihaben und sich nur noch zu bedienen brauchen. Zum Pech für sie nutzen sie zum Geldtransport dasselbe falsch verkabelte Flugzeug. Der betätigte Knopf aktiviert demnach auch bei ihnen nicht den Blitzableiter, sondern öffnet die Ladeluke. Donald und Tick, Trick und Track werden verdonnert, die Gegend abzugehen und die verstreuten Talersäcke aufzuklauben…

Positiv gedacht könnte man sagen: Die besonders kurze Geschichte (22 Seiten) von Michele Gazzarri ist so blöd, dass sie schon wieder gut ist. Zuerst denke ich da natürlich an die Szene, in der sich Dagobert und die Polizisten im Stärkeregen plötzlich nicht mehr von der Stelle rühren können: „Meine Uniform fühlt sich an wie aus festem Karton!“ (S. 21) Das hat was, und doch muss man letztlich wieder mal konstatieren, dass eine Story wirklich gut sein müsste, um eine von Giuseppe Perego gezeichnete Geschichte auf ein ordentliches Niveau zu bringen. Und das ist hier nun auch wieder nicht der Fall. Hobrowili (Diskussion) 11:21, 11. Mär. 2025 (CET)
Onkel Dagobert und die Probe aufs Exempel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
„Allerdings müssen sie sich eine Woche lang des Geldes würdig erweisen!“ – „Huch!“ (Derart vom Anwalt instruiert, mag Donald schon ahnen, dass ihm das schwer fallen dürfte)
![]() Im Bestreben, endlich an Geld zu kommen, kommt Donald im Kreditinstitut Nimmersatt mit Professor Leonardus ins Gespräch, der vor Jahren von Onkel Dagobert bei der Ausschlachtung einer genialen Erfindung übers Ohr gehauen wurde. Nach einer mehrtägigen Flucht vor seinen Gläubigern ins Grüne erfährt Donald, dass sein Onkel bei einer Explosion in seiner Feuerwerksfabrik ums Leben gekommen sei, und er zum Alleinerben eingesetzt worden sei, allerdings mit einwöchiger Probezeit, die von Dagoberts Verwaltungschef Fritz Fuchsig begleitet wird. Prompt setzt Donald alle Geschäfte, die er anfasst, in den Sand. Was er nicht weiß: Dagobert war einem Plan von Leonardus aufgesessen, sich in dessen Satelliten ins All schießen zu lassen, um von dort aus zu überprüfen, wie sein Erbe im Falle eines Falles wohl durchgebracht würde. Doch der rachsüchtige Leonardus denkt gar nicht daran, Dagobert zurückzuholen. Donald tut so, als würde er kooperieren, nur um den Schurken zu überwältigen und den Satelliten mit seinem Onkel an Bord zur Erde zurückzulotsen. Leonardus gibt aber nicht so leicht klein bei, verfängt sich dabei aber in der eigentlich für Donald vorgesehenen Riesen-Fangspule. Am Ende setzt Donald versehentlich den Hilfsmotor des Satelliten in Gang, und nun ist er es also, der um die Erde kreist. Dagobert hat es nicht eilig seinen Neffen zurückzuholen: „Zuerst muß ich das Vermögen wiederbeschaffen, das du verschleudert hast!“…
Im Bestreben, endlich an Geld zu kommen, kommt Donald im Kreditinstitut Nimmersatt mit Professor Leonardus ins Gespräch, der vor Jahren von Onkel Dagobert bei der Ausschlachtung einer genialen Erfindung übers Ohr gehauen wurde. Nach einer mehrtägigen Flucht vor seinen Gläubigern ins Grüne erfährt Donald, dass sein Onkel bei einer Explosion in seiner Feuerwerksfabrik ums Leben gekommen sei, und er zum Alleinerben eingesetzt worden sei, allerdings mit einwöchiger Probezeit, die von Dagoberts Verwaltungschef Fritz Fuchsig begleitet wird. Prompt setzt Donald alle Geschäfte, die er anfasst, in den Sand. Was er nicht weiß: Dagobert war einem Plan von Leonardus aufgesessen, sich in dessen Satelliten ins All schießen zu lassen, um von dort aus zu überprüfen, wie sein Erbe im Falle eines Falles wohl durchgebracht würde. Doch der rachsüchtige Leonardus denkt gar nicht daran, Dagobert zurückzuholen. Donald tut so, als würde er kooperieren, nur um den Schurken zu überwältigen und den Satelliten mit seinem Onkel an Bord zur Erde zurückzulotsen. Leonardus gibt aber nicht so leicht klein bei, verfängt sich dabei aber in der eigentlich für Donald vorgesehenen Riesen-Fangspule. Am Ende setzt Donald versehentlich den Hilfsmotor des Satelliten in Gang, und nun ist er es also, der um die Erde kreist. Dagobert hat es nicht eilig seinen Neffen zurückzuholen: „Zuerst muß ich das Vermögen wiederbeschaffen, das du verschleudert hast!“…
Die typische Jerry Siegel-Geschichte, also mit viel Action, Weltraum, Sci-Fi und Tam-Tam, wurde von Gino Esposito umgesetzt, einem 1945 in Ägypten geborenen Italiener, der in Deutschland eher in anderen Reihen als dem LTB veröffentlichte. Aus den 70er und 80er Jahren ist es nur diese Geschichte, die es in ein LTB schaffte. Espositos Zeichenstil lässt sich gar nicht einmal so übel an, wobei die riesigen Augen der Ducks auffällig sind, sowie ein gewisses Over-Acting der Figuren, woraus jedenfalls dieser Comic eine durchaus lebendige Wirkung bezieht. Ungewöhnlich sind auch einige, ich will sie mal „allegorische Panels“ nennen, die Donald in Großansicht von Symbolen umschweben lassen, die seine momentane Situation widerspiegeln, zum Beispiel auf S. 40 vom Geld, das er nicht hat, vor allem aber am Ende, im letzten Panel, von Stern- und Planeten-Symbolen, die für seine verzweifelte Lage in der Umlaufbahn stehen. Kein Wunder, hat sein Onkel doch soeben angekündigt, sein Testament ändern zu wollen. Alles in allem hätte ich von diesem Esposito in meiner Jugend, glaube ich, gerne noch etwas mehr lesen wollen. Hobrowili (Diskussion) 11:21, 11. Mär. 2025 (CET)
Die „Desperados“ von Entenhausen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
„Ich möchte Ihnen noch sagen, daß ich Karim VII., Großkalif des Sultanats von Taba-Taba bin…“ – Und ich bin Donald, Groß-Schuldner meines Onkels!“ (Titelhuberei beim Sultan und Donald)
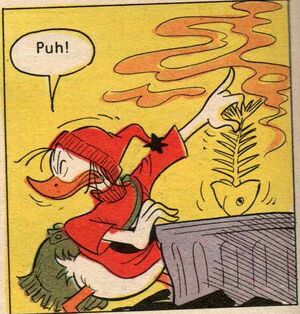
![]() Onkel Dagobert will groß ins Kaugummi-Geschäft einsteigen und engagiert Donald und Dussel, für ihn in Entenhausen ausgespuckte Kaugummis zu sammeln, um die Geschmacksvorlieben seiner potenziellen Kunden in Erfahrung zu bringen. Bei der entwürdigenden Arbeit wird Donald von einem orientalischen, steinreichen Sultan beobachtet, der ihn in seine – dem Leser zunächst noch unbekannte – Pläne hineinziehen will. Schließlich gesellen sich noch Tick, Trick, Track und Dussel zu der kleinen Gruppe, die nach Taba-Taba fliegt, die Heimat des Sultans. Doch von wegen Gruppe: „Truppe“ wäre eher richtig, denn die Entenhausener sollen quasi als Privatarmee Karims VII. dessen Onkel stürzen, der sich die Macht widerrechtlich angeeignet habe. Doch es stellt sich heraus, dass der Onkel selbst Opfer und Marionette seiner Offiziere war, die eigentlich hinter dem Putsch steckten. Karim und sein Onkel fallen sich wieder um den Hals, die Putschisten werden vertrieben. Der Konflikt hatte sich an einer „Giftkraut“-Plantage entzündet, die Karim ausrotten, der Generalstab aber erhalten wollte. Als sie zurück in Entenhausen sind, zürnt Dagobert seinen flüchtigen Kaugummi-Sammlern: Das „Giftkraut“ ist eine Pfefferminz-Pflanze, die auf seiner riesigen Plantage in Taba-Taba wächst, bzw. jetzt: wuchs. Donald und Dussel bleiben aber noch die beiden 200.000-Taler-Rubine, die sie als Vorschuss vom Sultan erhalten hatten…
Onkel Dagobert will groß ins Kaugummi-Geschäft einsteigen und engagiert Donald und Dussel, für ihn in Entenhausen ausgespuckte Kaugummis zu sammeln, um die Geschmacksvorlieben seiner potenziellen Kunden in Erfahrung zu bringen. Bei der entwürdigenden Arbeit wird Donald von einem orientalischen, steinreichen Sultan beobachtet, der ihn in seine – dem Leser zunächst noch unbekannte – Pläne hineinziehen will. Schließlich gesellen sich noch Tick, Trick, Track und Dussel zu der kleinen Gruppe, die nach Taba-Taba fliegt, die Heimat des Sultans. Doch von wegen Gruppe: „Truppe“ wäre eher richtig, denn die Entenhausener sollen quasi als Privatarmee Karims VII. dessen Onkel stürzen, der sich die Macht widerrechtlich angeeignet habe. Doch es stellt sich heraus, dass der Onkel selbst Opfer und Marionette seiner Offiziere war, die eigentlich hinter dem Putsch steckten. Karim und sein Onkel fallen sich wieder um den Hals, die Putschisten werden vertrieben. Der Konflikt hatte sich an einer „Giftkraut“-Plantage entzündet, die Karim ausrotten, der Generalstab aber erhalten wollte. Als sie zurück in Entenhausen sind, zürnt Dagobert seinen flüchtigen Kaugummi-Sammlern: Das „Giftkraut“ ist eine Pfefferminz-Pflanze, die auf seiner riesigen Plantage in Taba-Taba wächst, bzw. jetzt: wuchs. Donald und Dussel bleiben aber noch die beiden 200.000-Taler-Rubine, die sie als Vorschuss vom Sultan erhalten hatten…
Auch wenn er nicht vom Marktforschungshintergrund der Arbeit weiß, hat der Sultan sicher Recht: Jemand, der Kaugummis vom bloßen Gehsteigboden aufpult, muss wahrlich ein Verzweifelter, also ein „Desperado“ sein (von span. „desesperado“ wie „jeglicher Hoffnung beraubt“). Orientalische Potentaten brauchen solche Leute, um sich wieder an die Macht zurückzuputschen. Trotz der etwas hinterhältigen Rekrutierung für seine eigenen Machtinteressen sympathisiert der Leser gegen Ende doch mit dem zunächst etwas zwielichtigen Großprotz vom indischen Subkontinent, vor allem aber mit seinem zauseligen Onkel. Immerhin wenden sie sich offenbar mit lauteren Absichten gegen die fortschreitende Monokulturalisierung ihres Landes durch die raffgierigen Geschäftemacher der „Ersten Welt“, hier Dagobert. Geschickt fädeln Guido Martina und sein routiniert arbeitender Zeichner Romano Scarpa die Rückkehr zum Kaugummi-Motiv auf der vorletzten Seite ein, denn sicher darf der Leser ergänzen, dass das Pfefferminz aus Taba-Taba Hauptbestandteil jener Kaugummis gewesen wären, die Dagobert zu produzieren vorgehabt hätte, und wegen derer er Donald und Dussel am Anfang auf die Pirsch nach ausgespuckten Kaugummis geschickt hatte. So ereilt Dagobert wie die Strafe für sein großkapitalistisches, Natur und Mensch ausbeutendes Gehabe, ohne dass auf die klebrige Moral-Drüse gedrückt würde. Hobrowili (Diskussion) 11:21, 11. Mär. 2025 (CET)
Onkel Dagobert und die Superflasche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
„Klaas Klever! Schnell! Ich muß ihm die Superdinger abjagen!“ (Onkel Dagobert beginnt die wilde Flaschenjagd)
![]() Das Sammeln winziger Riechfläschchen ist unter Entenhausens Milliardären out, jetzt müssen es schon seltene Übergrößen von Weinflaschen sein. Der berühmte Sammler Graf Großfuß schenke dem Besitzer der vollständigsten Sammlung eine mit Edelsteinen besetzte Superflasche aus Platin. Und macht selbst ein Geschäft für sich daraus, verkauft er doch jetzt selbst Tausende von Flaschen an die „Jäger der Superflasche“. Dagobert Duck und Klaas Klever steigen ebenfalls in das Rennen ein, das sie ins Steingau führt, wo eine vergessene Nebukadnezum-Abfüllung des edlen Tropfens „Winzers Goldrebe“ auf ihren Finder warte. Doch auch Großfuß selbst muss sich leider dorthin bequemen, kann er doch, nachdem eine seiner Nebukadnezums zu Bruch gegangen ist, nicht mehr selbst die größte Sammlung sein Eigen nennen. Über das Steingauer Wintermuseum führt die wilde Hatz zum Fürsten Reblaus, dem angeblich letzten Käufer einer „Winters Goldrebe“. Klever und Dagobert meinen sich beständig gegenseitig übers Ohr zu hauen und mit dem Fürsten ins Geschäft zu kommen, doch im Kampf um die Nebukadnezum explodiert die Flasche – es handelt sich um Schaumwein – und legt im Nebenkeller einen Geheimvorrat an „Winzers Goldrebe“ frei. Dagobert triumphiert – hatte er sich doch bei Reblaus den Keller mit allem übrigen Wein, der sich darin findet, gesichert…
Das Sammeln winziger Riechfläschchen ist unter Entenhausens Milliardären out, jetzt müssen es schon seltene Übergrößen von Weinflaschen sein. Der berühmte Sammler Graf Großfuß schenke dem Besitzer der vollständigsten Sammlung eine mit Edelsteinen besetzte Superflasche aus Platin. Und macht selbst ein Geschäft für sich daraus, verkauft er doch jetzt selbst Tausende von Flaschen an die „Jäger der Superflasche“. Dagobert Duck und Klaas Klever steigen ebenfalls in das Rennen ein, das sie ins Steingau führt, wo eine vergessene Nebukadnezum-Abfüllung des edlen Tropfens „Winzers Goldrebe“ auf ihren Finder warte. Doch auch Großfuß selbst muss sich leider dorthin bequemen, kann er doch, nachdem eine seiner Nebukadnezums zu Bruch gegangen ist, nicht mehr selbst die größte Sammlung sein Eigen nennen. Über das Steingauer Wintermuseum führt die wilde Hatz zum Fürsten Reblaus, dem angeblich letzten Käufer einer „Winters Goldrebe“. Klever und Dagobert meinen sich beständig gegenseitig übers Ohr zu hauen und mit dem Fürsten ins Geschäft zu kommen, doch im Kampf um die Nebukadnezum explodiert die Flasche – es handelt sich um Schaumwein – und legt im Nebenkeller einen Geheimvorrat an „Winzers Goldrebe“ frei. Dagobert triumphiert – hatte er sich doch bei Reblaus den Keller mit allem übrigen Wein, der sich darin findet, gesichert…

Selten hätte es so gepasst, die Ducks auch mal angetütert zu sehen, wie in dieser 1973 von den Barosso-Brüdern erdachten Geschichte, die von Marco Rota mit seinem feinen Strich geschmackvoll und einem Hauch von satirischem Österreich-Bezug ausgeführt wurde. Doch den einzigen beduselten Zustand ereilt die beiden Konkurrenten Dagobert und Klever bereits, als sie an den Pforten des Milliardärsclubs mit den Köpfen zusammenrasseln. Danach bleibt alles nüchtern. Erzählerisch und zeichnerisch bleibt trotzdem bis zum Ende alles äußerst beschwingt und zügellos. Unter vielen guten Szenen seien mal nur das vibrierende Schloss des Grafen Großfuß genannt, als dieser entsetzt „ZERBROOOOOOCHEN?!?!“ ruft und damit alle Tiere des Waldes in Aufruhr versetzt (S. 128), dann die Szenen im Museum mit dem Wärter, der im Weinfass auflauert (S. 136), oder auch der im Bierfass zum Portal des Reblaus-Schlosses hinauskatapultierten Klever (S. 143). Als Schwäche bleibt die inkonsistent handelnde und von Rota etwas uneinheitlich gezeichnete Großfuß-Gestalt, deren Rolle letztlich unklar bleibt. Die Übersetzerin Gudrun Penndorf muss Spaß daran gehabt haben, die verschiedenen Flaschengrößen zum Teil mit Phantasienamen zu benennen – Bisthum, Sisthum, Raufthum, Saufthum (S. 126), die also offenbar ein klein wenig von den durch die gleiche Fachkraft benannten Römerlagern rund um das kleine gallische Dorf abbekommen haben. Hobrowili (Diskussion) 11:21, 11. Mär. 2025 (CET)
Onkel Dagobert und die Reise zu den Molukken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
„Oder wollt ihr vielleicht während der Fahrt verhungern?“ – „Nicht unbedingt!“ (Die Panzerknacker sorgen sich um ihre Vitalwerte)
![]() Nach dem Vorbild des Kolumbus segelt Onkel Dagobert auf dem alten verfallenen Schoner „Schnecke“ mit Donald und den Kindern auf die Insel Buru auf den Molukken und lädt dort Gewürze auf, um sie auf dem Entenhausener Großmarkt teuer zu verkaufen. Die Panzerknacker, als blinde Passagiere an Bord, überwältigen die Ducks, sind aber entsetzt, als sie nur Gewürze im Laderaum finden, von denen sie, wie sie meinen, außer einem höllischen Niesreiz nichts haben. Unterdes rettet Klaas Klever nicht eben uneigennützig die im Beiboot ausgesetzten Ducks. Der Schoner mit den Panzerknackern zerschellt an den Klippen einer kleinen Insel, die gesamte Ladung geht verloren. Doch Dagobert hat (wie immer) vorgesorgt und die „Schnecke“ teuer versichern lassen – bei einem Unternehmen, das Klever gehört…
Nach dem Vorbild des Kolumbus segelt Onkel Dagobert auf dem alten verfallenen Schoner „Schnecke“ mit Donald und den Kindern auf die Insel Buru auf den Molukken und lädt dort Gewürze auf, um sie auf dem Entenhausener Großmarkt teuer zu verkaufen. Die Panzerknacker, als blinde Passagiere an Bord, überwältigen die Ducks, sind aber entsetzt, als sie nur Gewürze im Laderaum finden, von denen sie, wie sie meinen, außer einem höllischen Niesreiz nichts haben. Unterdes rettet Klaas Klever nicht eben uneigennützig die im Beiboot ausgesetzten Ducks. Der Schoner mit den Panzerknackern zerschellt an den Klippen einer kleinen Insel, die gesamte Ladung geht verloren. Doch Dagobert hat (wie immer) vorgesorgt und die „Schnecke“ teuer versichern lassen – bei einem Unternehmen, das Klever gehört…
Mal wieder eine Story des Duos Dalmasso/Chierchini mit jener Bausatz-Anmutung, die viele dieser Geschichten so ungenießbar macht: Die Panzerknacker platzen in ein Geschäft Dagoberts hinein, gehen am Ende aber leer aus, ebenso wie Klaas Klever, der unvermittelt auf den Plan tritt, um den Karren aus dem Dreck der öden Handlung zu ziehen. Misslungen ist bereits der Beginn, als Tick, Trick und Track so gelehrt über Kolumbus palavern, sich dann aber über ihren Onkel lustig machen, als dieser nur die historische Selbstverständlichkeit ausspricht, Kolumbus sei an neuen Handelsrouten zu den Gewürzen Ostindiens interessiert gewesen. Chance verpasst, den jungen Lesern den jungen Lesern den Lauf der Welt geradezubiegen: „It’s the economy, stupid!“… Hobrowili (Diskussion) 11:21, 11. Mär. 2025 (CET)

Die Robinson-Neffen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
„Wie bist du denn aus der Falle rausgekommen?“ – „Ich hab einfach einen Freudensprung gemacht!“ (Die Panzerknacker müssen jedenfalls in dieser Geschichte keine Sorgen um ihre Vitalwerte machen)
![]() Gustav und Donald bringen Dagobert zur Weißglut mit ihrem erbschleicherischen Anwanzen an den steinreichen Onkel. Deshalb verfrachtet er die beiden unter dem Versprechen eines Urlaubs auf jeweils eine Südseeinsel, wo sie von da an ihr Dasein als „Robinson-Neffen“ fristen müssen. Gustav mit seinem Glück trifft das bessere Los: Denn parallel hatten die [[Panzerknacker mal wieder den Geldspeicher ausgeräumt und das ganze Geld in dem vermeintlich erloschenen Krater eines Vulkans auf Donalds Insel deponiert. Bei seinem Ausbruch wird jedoch das gesamte Geld auf die Nachbarinsel gespuckt, auf der Gustav nunmehr den Reichtum genießt und sich wie ein König aufführt. Die verzweifelten Panzerknacker graben Donalds Insel um auf der Suche nach den Schätzen, aber natürlich umsonst. Am Ende werden dennoch beide enterbt, Donald und Gustav: Ersterer, weil er zuerst entgegen einer Warnung das bereitgestellte Funkgerät benutzt hatte, um Alarm zu schlagen, letzterer, weil Dagobert, der sein Eigentum erfolgreich reklamieren kann, seine Talerchen doch niemals einem „Phantasten“ anvertrauen würde, „der sofort dem Größenwahn verfällt“ (S. 218)…
Gustav und Donald bringen Dagobert zur Weißglut mit ihrem erbschleicherischen Anwanzen an den steinreichen Onkel. Deshalb verfrachtet er die beiden unter dem Versprechen eines Urlaubs auf jeweils eine Südseeinsel, wo sie von da an ihr Dasein als „Robinson-Neffen“ fristen müssen. Gustav mit seinem Glück trifft das bessere Los: Denn parallel hatten die [[Panzerknacker mal wieder den Geldspeicher ausgeräumt und das ganze Geld in dem vermeintlich erloschenen Krater eines Vulkans auf Donalds Insel deponiert. Bei seinem Ausbruch wird jedoch das gesamte Geld auf die Nachbarinsel gespuckt, auf der Gustav nunmehr den Reichtum genießt und sich wie ein König aufführt. Die verzweifelten Panzerknacker graben Donalds Insel um auf der Suche nach den Schätzen, aber natürlich umsonst. Am Ende werden dennoch beide enterbt, Donald und Gustav: Ersterer, weil er zuerst entgegen einer Warnung das bereitgestellte Funkgerät benutzt hatte, um Alarm zu schlagen, letzterer, weil Dagobert, der sein Eigentum erfolgreich reklamieren kann, seine Talerchen doch niemals einem „Phantasten“ anvertrauen würde, „der sofort dem Größenwahn verfällt“ (S. 218)…
Was die Logik der Geschichte anbetrifft, stimmt nur recht wenig. Nicht mal der mickrigste Taler soll auf Donalds Insel verblieben sein, das Geld aus dem Vulkankegel gar nur in eine einzige Himmelsrichtung gesprengt worden sein – wer glaubt denn so was. Auf der anderen Seite sind die Aktivitäten, die Gustav und Donald zu Beginn entfalten, ihrem Onkel zu gefallen, in ihrer Übertreibung ganz putzig anzuschauen, und auch ihre Überlebensübungen auf ihren einsamen Inseln sind noch halbwegs lesenswert. Die Panzerknacker-Handlung ist hingegen wieder mal ziemlich einfallslos, da kann die Bande noch so nachdrücklich beteuern, die Idee, den Boden unter dem Geldspeicher auszuhöhlen, damit dieser absackt, sei noch nie dagewesen. Am besten gefällt mir aber, dass die Zeichnungen von Guido Scala hier seinem Lehrmeister Luciano Bottaro besonders nahekommen. Hobrowili (Diskussion) 11:21, 11. Mär. 2025 (CET)
Onkel Dagobert und die Kunst der Selbstverteidigung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
„Jetzt sind wir genau über der Stelle, an der die „Unsinkbare“ gesunken ist! Bist du soweit? Keine Angst, es ist völlig ungefährlich!“ (Dagobert motiviert seinen Neffen – und das war sogar noch vor den Haifischen)
![]() Die Wahl Dagoberts zum Präsidenten des Millionärsclubs droht zu scheitern, weil Klaas Klever vorbringt, Dagobert habe sich im Jahr 1905 bei seinem Großvater Wilhelm Wucherl einen Taler geliehen und bis heute ihm, dem rechtmäßigen Erben, nicht zurückgezahlt, mal ganz abgesehen von Zins und Zinseszins. Dagobert hingegen beschwört, den Taler bereits 24 Stunden später berappt zu haben, doch die Quittung liege in einer Kabine des Schiffes, auf dem er damals reiste, auf dem Meeresgrund. Mithilfe einer Erfindung Düsentriebs gelingt es Donald, den Koffer aus dem Wrack zu bergen, der ihm jedoch postwendend von den Panzerknackern entrissen wird. Diese können mit dem augenscheinlich wertlosen Inhalt nichts anfangen und überlassen ihn wieder Dagobert – außer Spesen nichts gewesen. Zurück im Club, loben die Millionärskollegen Dagoberts „hieb- und stichfeste Beweisführung“ (S. 252) und bestätigen ihn unter allgemeinem Jubel im Amt…
Die Wahl Dagoberts zum Präsidenten des Millionärsclubs droht zu scheitern, weil Klaas Klever vorbringt, Dagobert habe sich im Jahr 1905 bei seinem Großvater Wilhelm Wucherl einen Taler geliehen und bis heute ihm, dem rechtmäßigen Erben, nicht zurückgezahlt, mal ganz abgesehen von Zins und Zinseszins. Dagobert hingegen beschwört, den Taler bereits 24 Stunden später berappt zu haben, doch die Quittung liege in einer Kabine des Schiffes, auf dem er damals reiste, auf dem Meeresgrund. Mithilfe einer Erfindung Düsentriebs gelingt es Donald, den Koffer aus dem Wrack zu bergen, der ihm jedoch postwendend von den Panzerknackern entrissen wird. Diese können mit dem augenscheinlich wertlosen Inhalt nichts anfangen und überlassen ihn wieder Dagobert – außer Spesen nichts gewesen. Zurück im Club, loben die Millionärskollegen Dagoberts „hieb- und stichfeste Beweisführung“ (S. 252) und bestätigen ihn unter allgemeinem Jubel im Amt…
Bis auf ein paar Panels mit Donald „bei den Haien“ (S. 233) ist die letzte Geschichte des Bandes ein missratener Rausschmeißer. Diese Schwachheit, der Giancarlo Gatti mit seinen unperspektivischen Zeichnungen schon mal gar nicht auf die Beine helfen kann, ist wieder auf dem Mist Gian Giacomo Dalmassos gewachsen, der wie in der Molukken-Story weiter vorne im Band eine Panzerknacker- und eine Klever-Handlung ächzend miteinander verleimt. Besonders sauer stößt mir dieser überflüssige Hafenbehörden-Roboter (aus dem Jahr 1905!) auf. Sicher ist es auch kein Zufall, dass diesmal nur zwei Panzerknacker die Beute unter sich aufteilen wollen – Gatti war offenbar diesmal sogar zu knapp an Zeit, um eine ganze Bande in Szene zu setzen. Hobrowili (Diskussion) 11:21, 11. Mär. 2025 (CET)
Fazit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Neben einer soliden Leistung Scarpas steht das „Haben“ diesmal im Zeichen der in den LTBs nicht eben häufig veröffentlichten Gino Esposito und Marco Rota. Die „üblichen Verdächtigen“ Dalmasso, Perego, Chierchini und Gatti ziehen den Band als Ganzes letztlich aber doch entschieden in die Miesen. Hobrowili (Diskussion) 11:21, 11. Mär. 2025 (CET)