Carl Barks: Unterschied zwischen den Versionen
McDuck (Diskussion | Beiträge) |
Sonic (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Carl Barks fing 1942 an, sich neben seiner Arbeit in den [[Disney-Studios]] auch mit dem Zeichnen von [[Comicgeschichte]]n für den [[Western Publishing|Western]]-Verlag zu beschäftigen. Sein erster gemeinsam mit [[Jack Hannah]] gezeichneter Comic – dem nur die Mitarbeit am Skript eines [[Pluto]]-Comics vorausging – war ''[[Piratengold]]'', eine Adaption eines letztendlich abgelehnten Filmprojektes. Die Geschichte kennzeichnet sich durch spärliche Dialoge und wenig Hintergrundgestaltung und weist nur andeutungsweise auf Carl Barks spätere Begabung hin. Wie auch die ersten Zehnseiter, die für die Publikation [[Walt Disneys Comics and Stories]] entstanden – der erste war ''[[Gesundheitsgemüse]]'' – prägte Barks' Mitarbeit in den Studios seine [[Comic-Skript|Skripts]] und Zeichnungen. Die Zehnseiter, in dieser Phase Barks' wesentlichste Arbeiten, lehnten sich an Donald-Cartoons an und zeigten dementsprechend oft Wettkämpfe zwischen Donald und seinen [[Tick, Trick und Track|Neffen]] oder Donalds berühmtes unberechenbares Temperament, das am deutlichsten in Auseinandersetzungen mit dem in dieser Phase kreierten Nachbarn [[Zorngiebel]] zum Ausdruck kam. | Carl Barks fing 1942 an, sich neben seiner Arbeit in den [[Disney-Studios]] auch mit dem Zeichnen von [[Comicgeschichte]]n für den [[Western Publishing|Western]]-Verlag zu beschäftigen. Sein erster gemeinsam mit [[Jack Hannah]] gezeichneter Comic – dem nur die Mitarbeit am Skript eines [[Pluto]]-Comics vorausging – war ''[[Piratengold]]'', eine Adaption eines letztendlich abgelehnten Filmprojektes. Die Geschichte kennzeichnet sich durch spärliche Dialoge und wenig Hintergrundgestaltung und weist nur andeutungsweise auf Carl Barks spätere Begabung hin. Wie auch die ersten Zehnseiter, die für die Publikation [[Walt Disneys Comics and Stories]] entstanden – der erste war ''[[Gesundheitsgemüse]]'' – prägte Barks' Mitarbeit in den Studios seine [[Comic-Skript|Skripts]] und Zeichnungen. Die Zehnseiter, in dieser Phase Barks' wesentlichste Arbeiten, lehnten sich an Donald-Cartoons an und zeigten dementsprechend oft Wettkämpfe zwischen Donald und seinen [[Tick, Trick und Track|Neffen]] oder Donalds berühmtes unberechenbares Temperament, das am deutlichsten in Auseinandersetzungen mit dem in dieser Phase kreierten Nachbarn [[Zorngiebel]] zum Ausdruck kam. | ||
[[Datei:Sumpfgnome-3.jpg|thumb|150px|rechts|Die Gnixen hatten ihren eigenen Gott mit ihren eigenen Ritualen…]] | [[Datei:Sumpfgnome-3.jpg|thumb|150px|rechts|Die Gnixen hatten ihren eigenen Gott mit ihren eigenen Ritualen…]] | ||
Lange Donald-Duck-Geschichten orientierten sich oft an den [[Micky Maus|Micky-Maus]]-Abenteuern von [[Floyd Gottfredson]]. Barks sah sich hauptsächlich als Künstler, der witzige Ideen für siebenminütige Cartoons oder zehnseitige Comics hervorbrachte. Lange Geschichten bereiteten ihm eher Probleme.<ref>Blum: Der „klassische Barks“, S. 32, 34.</ref> Gottfredsons Micky-Maus-Comics waren tendenziell ernste Geschichten und auch Barks thematisierte in seinen Comics bedrohliche Situationen, Psychopathen, Zerstörungen, körperliche Schäden wie Donalds Erblinden in ''[[Nordische Nächte]]''. In etlichen dieser Geschichten taucht [[Kater Karlo]] als Gegenspieler Donalds auf, was indiziert, dass Barks die Geschichte als klassischen Micky-Comic strukturierte. Vielfach waren exotische Schauplätze handlungsleitend und Donalds Charakter trat in den Hintergrund. Dies lässt sich auch über ''[[Die Sumpfgnome]]'' sagen, auch wenn die Geschichte in anderer Hinsicht einen Meilenstein in Barks' Schaffen darstellt. Erstmals erschuf er hier ein „[[Carl Barks' Völker|vergessenes“ Volk]], etwas, das er viele Male wiederholen sollte. Viele Besonderheiten der [[Gnixen]] verwendete Barks für weitere seiner Kreationen; ''Die Sumpfgnome'' brachte ihm Stoff für mehr als ein Jahrzehnt. | Lange Donald-Duck-Geschichten orientierten sich oft an den [[Micky Maus|Micky-Maus]]-Abenteuern von [[Floyd Gottfredson]]. Barks sah sich hauptsächlich als Künstler, der witzige Ideen für siebenminütige Cartoons oder zehnseitige Comics hervorbrachte. Lange Geschichten bereiteten ihm eher Probleme.<ref>Blum: Der „klassische Barks“, S. 32, 34.</ref> Gottfredsons Micky-Maus-Comics waren tendenziell ernste Geschichten und auch Barks thematisierte in seinen Comics bedrohliche Situationen, Psychopathen, Zerstörungen, körperliche Schäden wie Donalds Erblinden in ''[[Nordische Nächte]]''. In etlichen dieser Geschichten taucht [[Kater Karlo]] als Gegenspieler Donalds auf, was indiziert, dass Barks die Geschichte als klassischen Micky-Comic strukturierte. Vielfach waren exotische Schauplätze handlungsleitend und Donalds Charakter trat in den Hintergrund. Dies lässt sich auch über ''[[Die Sumpfgnome]]'' sagen, auch wenn die Geschichte in anderer Hinsicht einen Meilenstein in Barks' Schaffen darstellt. Erstmals erschuf er hier ein „[[Carl Barks' Völker|vergessenes“ Volk]], etwas, das er viele Male wiederholen sollte. Viele Besonderheiten der [[Gnixen]] verwendete Barks für weitere seiner Kreationen; ''Die Sumpfgnome'' brachte ihm Stoff für mehr als ein Jahrzehnt. | ||
| Zeile 65: | Zeile 64: | ||
[[Datei:Geist der Grotte-4.jpg|thumb|300px|links|''[[Der Geist der Grotte]]'' und ''[[Das Gespenst von Duckenburgh]]''. Barks verwendete für diese Geschichten erstmals die Gier nach Gold als handlungsleitendes Motiv (© Egmont Ehapa)]] | [[Datei:Geist der Grotte-4.jpg|thumb|300px|links|''[[Der Geist der Grotte]]'' und ''[[Das Gespenst von Duckenburgh]]''. Barks verwendete für diese Geschichten erstmals die Gier nach Gold als handlungsleitendes Motiv (© Egmont Ehapa)]] | ||
Barks' klassische Phase beginnt nach Ansicht von [[Geoffrey Blum]]<ref>Blum: Der „klassische“ Barks.</ref> mit der Geschichte ''[[Der Geist der Grotte]]''. Es spricht einiges dafür, eine neue Phase in Barks' Schaffen ab etwa diesem Zeitpunkt anzusetzen. Mit ''Der Geist der Grotte'' schuf Barks erstmals eine Geschichte, die nicht nur vom exotischen Schauplatz oder der guten Story lebte, sondern auch eine eindrucksvolle Charakterisierung der Hauptfiguren bot, inklusive eines letztendlich sympathischen Gegenspielers und der neuaufgegriffenen Thematik der Gier nach Gold. In dieser Geschichte benützte Barks zudem das erste Mal ein [[Splash-Panel]]. | Barks' klassische Phase beginnt nach Ansicht von [[Geoffrey Blum]]<ref>Blum: Der „klassische“ Barks.</ref> mit der Geschichte ''[[Der Geist der Grotte]]''. Es spricht einiges dafür, eine neue Phase in Barks' Schaffen ab etwa diesem Zeitpunkt anzusetzen. Mit ''Der Geist der Grotte'' schuf Barks erstmals eine Geschichte, die nicht nur vom exotischen Schauplatz oder der guten Story lebte, sondern auch eine eindrucksvolle Charakterisierung der Hauptfiguren bot, inklusive eines letztendlich sympathischen Gegenspielers und der neuaufgegriffenen Thematik der Gier nach Gold. In dieser Geschichte benützte Barks zudem das erste Mal ein [[Splash-Panel]]. | ||
[[Datei:Sheriff von Bullet Valley-Cover.jpeg|thumb| | [[Datei:Sheriff von Bullet Valley-Cover.jpeg|thumb|250px|rechts|''[[Der Sheriff von Bullet Valley]]'', eines der bekanntesten Donald-Abenteuer (© Disney)]] | ||
Binnen weniger Monate kreierte Barks zwei seiner wichtigsten Schöpfungen: [[Dagobert Duck]] (erster Auftritt in ''[[Die Mutprobe]]'', Dezember 1947) und [[Gustav Gans]] (erster Auftritt in ''[[Die Wette]]'', Januar 1948). Gustav sollte bald zum Standardpersonal der kurzen Zehnseiter werden, die sich nun vermehrt dem Konfliktdreieck Donald – Gustav – Daisy widmeten, während der Konflikt zwischen Donald und seinen Neffen weitgehend in den Hintergrund gedrängt wurde. Ein weiteres Motiv für die Zehnseiter war, Donald in der Ausübung eines Berufes zu zeigen, bei der jedoch laufend Missgeschicke passierten. Bereits zuvor hatte Barks sich an diesem Genre versucht, aber jetzt entstanden Klassiker wie ''[[Die Schulschwänzer (1949)|Die Schulschwänzer]]'' oder ''[[Kommt zur Küstenwache!]]'', die das Pech bald zu Donalds hervorstechendster Eigenschaft machten, nachdem es zu Beginn noch das cholerische Temperament gewesen war. In ähnlicher Weise dienten die Zehnseiter dazu, Gustavs Charakter zu formen und ihm sein sagenhaftes Glück zu verleihen (wobei dafür ebenso bedeutend die lange Geschichte ''[[Segelregatta in die Südsee]]'' war). Dasselbe geschah mit Dagobert, der zunächst durch seine Habgier, später durch seinen Geiz gekennzeichnet wurde. Sein unfassbarer Reichtum vergrößerte sich in den Zehnseitern immer mehr, bis er schließlich seinen [[Geldspeicher]] bekam (''[[Eingefrorenes Geld]]'') und offiziell zum reichsten Mann der Welt wurde (''[[Der reichste Mann der Welt (1952)|Der reichste Mann der Welt]]''). Nur am Rande zu erwähnen sei hier, dass auch [[Daniel Düsentrieb]], die [[Panzerknacker]] und das [[Fähnlein Fieselschweif]] in den Zehnseitern jener Jahre das Licht der Welt erblickten, wobei Barks sie erst in den folgenden Jahren vermehrt einsetzen sollte. Die Jahre 1947 bis 1952 sind damit auch jene, in denen die wichtigsten Bewohner [[Entenhausen]]s von Barks geschaffen und geformt wurden. | Binnen weniger Monate kreierte Barks zwei seiner wichtigsten Schöpfungen: [[Dagobert Duck]] (erster Auftritt in ''[[Die Mutprobe]]'', Dezember 1947) und [[Gustav Gans]] (erster Auftritt in ''[[Die Wette]]'', Januar 1948). Gustav sollte bald zum Standardpersonal der kurzen Zehnseiter werden, die sich nun vermehrt dem Konfliktdreieck Donald – Gustav – Daisy widmeten, während der Konflikt zwischen Donald und seinen Neffen weitgehend in den Hintergrund gedrängt wurde. Ein weiteres Motiv für die Zehnseiter war, Donald in der Ausübung eines Berufes zu zeigen, bei der jedoch laufend Missgeschicke passierten. Bereits zuvor hatte Barks sich an diesem Genre versucht, aber jetzt entstanden Klassiker wie ''[[Die Schulschwänzer (1949)|Die Schulschwänzer]]'' oder ''[[Kommt zur Küstenwache!]]'', die das Pech bald zu Donalds hervorstechendster Eigenschaft machten, nachdem es zu Beginn noch das cholerische Temperament gewesen war. In ähnlicher Weise dienten die Zehnseiter dazu, Gustavs Charakter zu formen und ihm sein sagenhaftes Glück zu verleihen (wobei dafür ebenso bedeutend die lange Geschichte ''[[Segelregatta in die Südsee]]'' war). Dasselbe geschah mit Dagobert, der zunächst durch seine Habgier, später durch seinen Geiz gekennzeichnet wurde. Sein unfassbarer Reichtum vergrößerte sich in den Zehnseitern immer mehr, bis er schließlich seinen [[Geldspeicher]] bekam (''[[Eingefrorenes Geld]]'') und offiziell zum reichsten Mann der Welt wurde (''[[Der reichste Mann der Welt (1952)|Der reichste Mann der Welt]]''). Nur am Rande zu erwähnen sei hier, dass auch [[Daniel Düsentrieb]], die [[Panzerknacker]] und das [[Fähnlein Fieselschweif]] in den Zehnseitern jener Jahre das Licht der Welt erblickten, wobei Barks sie erst in den folgenden Jahren vermehrt einsetzen sollte. Die Jahre 1947 bis 1952 sind damit auch jene, in denen die wichtigsten Bewohner [[Entenhausen]]s von Barks geschaffen und geformt wurden. | ||
[[Datei:Lost in the Andes-Cover.jpeg|thumb| | [[Datei:Lost in the Andes-Cover.jpeg|thumb|250px|left|''[[Im Land der viereckigen Eier]]'', ein typisches Beispiel eines langen Donald-Duck-Abenteuers und eine der besten Disney-Geschichten überhaupt (© Disney)]] | ||
Das eigentliche Kennzeichen dieser Phase sind allerdings die langen Donald-Duck-Geschichten, die in großer Zahl in verhältnismäßig kurzer Zeit entstanden (es entstanden 25 solche Geschichten verglichen mit nur 9 in der vorangegangenen Phase) und von denen viele zu Barks' besten Geschichten zählen. Auf ''Der Geist der Grotte'' folgten ''Die Mutprobe'', ''[[Das Gespenst von Duckenburgh]]'' und schließlich, im Abstand von einem Jahr ''[[Sheriff von Bullet Valley]]'' und ''[[Im Land der viereckigen Eier]]'', eine erste Krönung seines Schaffens. Während der ''Sheriff'' eine große Charakterstudie von Donald ist, vielleicht die beste, die Barks je geschrieben hat, greift ''Im Land der viereckigen Eier'' das Thema der vergessenen Kultur wieder auf und gilt in seiner Konstruktion und Gestaltung als eine der besten Disney-Geschichten überhaupt. Zwei weitere Geschichten, ''[[Wudu-Hudu-Zauber]]'' und ''[[Vor Neugier wird gewarnt]]'' griffen nochmals das Horror-Thema der vorangegangenen Phase auf, gestalteten es aber deutlich liebevoller und witziger. Mit ''[[Gefährliches Spiel]]'' führte er Donald in die Welt der Spione ein. Barks schickte Donald nun mehrfach auf die Suche nach historischen Schätzen oder ließ ihn historische Personen treffen (''[[Die Jagd auf das Einhorn]]'', ''[[Im alten Kalifornien]]'', ''[[Der Goldene Helm]]'' und ''[[Jagd nach der Roten Magenta]]''). In dieser Phase entstanden Barks' beste Weihnachtsgeschichten, die oft den Konflikt zwischen Donald und seinem geizigen Onkel herausstrichen (erwähnenswert sind hier vor allem ''[[Zu viele Weihnachtsmänner]]'' und ''[[Weihnachten für Kummersdorf]]''). In ''Zu viele Weihnachtsmänner'' experimentierte Barks erstmals mit der Panelgestaltung (siehe Abschnitt zum Stil), eine Technik, die er auch auf ''[[Familie Duck auf Ferienfahrt]]'' und ''[[Die Jagd nach der Brosche]]'' anwenden sollte. Den Reigen an langen Donald-Duck-Geschichten dieser Phase beendet Barks mit ''[[Spendieren oder Schikanieren]]'' und schließt gewissermaßen den Kreis zu ''Die Mutprobe'', die am Anfang dieser Phase stand: Nunmehr soll Donald zum Halloween-Fest bekehrt werden. | Das eigentliche Kennzeichen dieser Phase sind allerdings die langen Donald-Duck-Geschichten, die in großer Zahl in verhältnismäßig kurzer Zeit entstanden (es entstanden 25 solche Geschichten verglichen mit nur 9 in der vorangegangenen Phase) und von denen viele zu Barks' besten Geschichten zählen. Auf ''Der Geist der Grotte'' folgten ''Die Mutprobe'', ''[[Das Gespenst von Duckenburgh]]'' und schließlich, im Abstand von einem Jahr ''[[Sheriff von Bullet Valley]]'' und ''[[Im Land der viereckigen Eier]]'', eine erste Krönung seines Schaffens. Während der ''Sheriff'' eine große Charakterstudie von Donald ist, vielleicht die beste, die Barks je geschrieben hat, greift ''Im Land der viereckigen Eier'' das Thema der vergessenen Kultur wieder auf und gilt in seiner Konstruktion und Gestaltung als eine der besten Disney-Geschichten überhaupt. Zwei weitere Geschichten, ''[[Wudu-Hudu-Zauber]]'' und ''[[Vor Neugier wird gewarnt]]'' griffen nochmals das Horror-Thema der vorangegangenen Phase auf, gestalteten es aber deutlich liebevoller und witziger. Mit ''[[Gefährliches Spiel]]'' führte er Donald in die Welt der Spione ein. Barks schickte Donald nun mehrfach auf die Suche nach historischen Schätzen oder ließ ihn historische Personen treffen (''[[Die Jagd auf das Einhorn]]'', ''[[Im alten Kalifornien]]'', ''[[Der Goldene Helm]]'' und ''[[Jagd nach der Roten Magenta]]''). In dieser Phase entstanden Barks' beste Weihnachtsgeschichten, die oft den Konflikt zwischen Donald und seinem geizigen Onkel herausstrichen (erwähnenswert sind hier vor allem ''[[Zu viele Weihnachtsmänner]]'' und ''[[Weihnachten für Kummersdorf]]''). In ''Zu viele Weihnachtsmänner'' experimentierte Barks erstmals mit der Panelgestaltung (siehe Abschnitt zum Stil), eine Technik, die er auch auf ''[[Familie Duck auf Ferienfahrt]]'' und ''[[Die Jagd nach der Brosche]]'' anwenden sollte. Den Reigen an langen Donald-Duck-Geschichten dieser Phase beendet Barks mit ''[[Spendieren oder Schikanieren]]'' und schließt gewissermaßen den Kreis zu ''Die Mutprobe'', die am Anfang dieser Phase stand: Nunmehr soll Donald zum Halloween-Fest bekehrt werden. | ||
=== Blütephase der Onkel-Dagobert-Geschichten (ca. 1952 – 1958) === | === Blütephase der Onkel-Dagobert-Geschichten (ca. 1952 – 1958) === | ||
[[Datei:Der arme reiche Mann-Cover.jpeg| | [[Datei:Der arme reiche Mann-Cover.jpeg|thumb|250px|rechts|''[[Der arme reiche Mann]]'', klassisches Beispiel der Onkel-Dagobert-Abenteuer (© Disney)]] | ||
Barks' wichtigste Schöpfung Dagobert war von ihm zunehmend weiter entwickelt und sympathischer gestaltet worden. Die Figur kam bei den Lesern auch immer besser an, weswegen [[Western Publishing]] beschloss, ihr eine eigene Heftreihe zu geben, „[[Uncle Scrooge (Amerikanische Comicreihe)|Uncle Scrooge]]“. Barks bekam den Auftrag, fortan und bis zu seinem Ruhestand die Hefte fast im Alleingang zu gestalten; nur gelegentlich wirkten andere Autoren und Zeichner mit. Die erste Geschichte, die Barks für das neue Heft schrieb, war ''[[Der arme reiche Mann]]'', das in vielerlei Hinsicht einen erneuten Meilenstein in Barks' Schaffen markierte. Die Geschichte diente als große Charakterstudie Dagoberts und zeigte ihn als schrulligen, bisweilen geizigen, aber äußerst liebenswerten alten Mann. Nachdem Barks sich bislang weitgehend über die Herkunft von Dagoberts Vermögen ausgeschwiegen hatte (in den wenigen Fällen hatte er ihn als skrupellosen Räuber oder als vom Glück Begünstigten dargestellt), schrieb er ihm mit dieser Geschichte gewissermaßen eine Biographie auf den Leib und legte fest, dass er sein Vermögen am Klondike gemacht hatte. Die Geschichte gibt auch erstmals den Panzerknackern eine tragendere Rolle und etabliert sie als Dagoberts Hauptgegner. | Barks' wichtigste Schöpfung Dagobert war von ihm zunehmend weiter entwickelt und sympathischer gestaltet worden. Die Figur kam bei den Lesern auch immer besser an, weswegen [[Western Publishing]] beschloss, ihr eine eigene Heftreihe zu geben, „[[Uncle Scrooge (Amerikanische Comicreihe)|Uncle Scrooge]]“. Barks bekam den Auftrag, fortan und bis zu seinem Ruhestand die Hefte fast im Alleingang zu gestalten; nur gelegentlich wirkten andere Autoren und Zeichner mit. Die erste Geschichte, die Barks für das neue Heft schrieb, war ''[[Der arme reiche Mann]]'', das in vielerlei Hinsicht einen erneuten Meilenstein in Barks' Schaffen markierte. Die Geschichte diente als große Charakterstudie Dagoberts und zeigte ihn als schrulligen, bisweilen geizigen, aber äußerst liebenswerten alten Mann. Nachdem Barks sich bislang weitgehend über die Herkunft von Dagoberts Vermögen ausgeschwiegen hatte (in den wenigen Fällen hatte er ihn als skrupellosen Räuber oder als vom Glück Begünstigten dargestellt), schrieb er ihm mit dieser Geschichte gewissermaßen eine Biographie auf den Leib und legte fest, dass er sein Vermögen am Klondike gemacht hatte. Die Geschichte gibt auch erstmals den Panzerknackern eine tragendere Rolle und etabliert sie als Dagoberts Hauptgegner. | ||
[[Datei:Wiedersehn mit Klondike-Cover.jpeg|thumb| | [[Datei:Wiedersehn mit Klondike-Cover.jpeg|thumb|250px|links|''[[Wiedersehn mit Klondike]]'', der nächste große Meilenstein in der Entwicklung Dagoberts (© Disney)]] | ||
Auf ''Der arme reiche Mann'' folgte ''[[Wiedersehn mit Klondike]]'', in der Barks ausführlicher auf Dagoberts Vergangenheit als Goldgräber einging und ihn – in einer zensierten vierseitigen [[Rückblende]] – als jungen Helden zeigte, der zahllose Schurken auf einmal erledigen konnte. Genau wie die folgende lange Dagobert-Geschichte ''[[13 Trillionen]]'' machte ''Wiedersehn mit Klondike'' deutlich, wer Dagobert jetzt war und zeigte gut seine weichen Seiten. Dagobert hatte sich vom Antagonisten Donalds zum wahren Helden gewandelt, der weder [[Nelly]] ins Armenhaus gehen noch seinen Gegner Schmu Schubiack ertrinken ließ.<ref>Vgl. für Barks Selbsteinschätzung dieser Geschichte Blum: Der „klassische“ Barks, S. 30.</ref> | Auf ''Der arme reiche Mann'' folgte ''[[Wiedersehn mit Klondike]]'', in der Barks ausführlicher auf Dagoberts Vergangenheit als Goldgräber einging und ihn – in einer zensierten vierseitigen [[Rückblende]] – als jungen Helden zeigte, der zahllose Schurken auf einmal erledigen konnte. Genau wie die folgende lange Dagobert-Geschichte ''[[13 Trillionen]]'' machte ''Wiedersehn mit Klondike'' deutlich, wer Dagobert jetzt war und zeigte gut seine weichen Seiten. Dagobert hatte sich vom Antagonisten Donalds zum wahren Helden gewandelt, der weder [[Nelly]] ins Armenhaus gehen noch seinen Gegner Schmu Schubiack ertrinken ließ.<ref>Vgl. für Barks Selbsteinschätzung dieser Geschichte Blum: Der „klassische“ Barks, S. 30.</ref> | ||
| Zeile 269: | Zeile 268: | ||
[[Datei:A Tall Ship and a Star to Steer Her By.jpg|thumb|250px|links|''A Tall Ship and a Star to Steer Her By'', das erste Ölgemälde mit den Ducks (© Disney)]] | [[Datei:A Tall Ship and a Star to Steer Her By.jpg|thumb|250px|links|''A Tall Ship and a Star to Steer Her By'', das erste Ölgemälde mit den Ducks (© Disney)]] | ||
Als Katalysator für Disney-Gemälde gilt Glenn Bray, ein südkalifornischer Fan, der im Mai 1971 das erste Ölgemälde mit Donald Duck in Auftrag gab. Carl Barks hielt die Ducks in Öl für wenig erfolgversprechend. Bray bot ihm aber 150 Dollar, egal wie das Ergebnis ausfallen würde. Barks willigte ein und malte das [[Titelbild]] von ''Walt Disney’s Comics and Stories 108'' in Öl. Während Barks an dem Bild malte, bat er George Sherman, Leiter der Publikationsabteilung bei Disney, um Erlaubnis. Diese erhielt er, als er mit dem Bild bereits fertig war, dazu bekam er auch eine Warteliste von Fans für zukünftige Gemälde. Auch wenn Bray das erste offizielle Bild erhalten hat, so hatte bereits der Dozent Donald Ault 1970 ein Bild ohne Ducks aus der Geschichte ''[[Der arme reiche Mann]]'' erhalten. <ref>Blum, G. (2012). Carl Barks – Die Ölgemälde. (G. Syllwasschy, Übers.) Köln: EGMONT Verlagsgesellschaft mbH. S. 11–13.</ref> | Als Katalysator für Disney-Gemälde gilt Glenn Bray, ein südkalifornischer Fan, der im Mai 1971 das erste Ölgemälde mit Donald Duck in Auftrag gab. Carl Barks hielt die Ducks in Öl für wenig erfolgversprechend. Bray bot ihm aber 150 Dollar, egal wie das Ergebnis ausfallen würde. Barks willigte ein und malte das [[Titelbild]] von ''Walt Disney’s Comics and Stories 108'' in Öl. Während Barks an dem Bild malte, bat er George Sherman, Leiter der Publikationsabteilung bei Disney, um Erlaubnis. Diese erhielt er, als er mit dem Bild bereits fertig war, dazu bekam er auch eine Warteliste von Fans für zukünftige Gemälde. Auch wenn Bray das erste offizielle Bild erhalten hat, so hatte bereits der Dozent Donald Ault 1970 ein Bild ohne Ducks aus der Geschichte ''[[Der arme reiche Mann]]'' erhalten. <ref>Blum, G. (2012). Carl Barks – Die Ölgemälde. (G. Syllwasschy, Übers.) Köln: EGMONT Verlagsgesellschaft mbH. S. 11–13.</ref> | ||
Barks erhielt die kostenlose Lizenz Ölbilder zu malen, unter der Bedingung, dass die Werke künstlerischen Wert haben würden und nicht günstiger als für 25 USD angeboten werden, dazu musste „© Walt Disney Productions“ auf die Vorderseite des Bildes. Carl Barks durfte die Bilder mit eigenem Namen signieren, Bleistift- und Tuschezeichnungen waren hier aber nicht inkludiert. Die Lizenz galt bis Ende des Jahres bzw. bis auf Widerruf. Er war mit Aufträgen und anderen Projekten so eingedeckt (z.B. [[Comic-Skript|Skripte]] für das [[Fähnlein Fieselschweif]]), dass er begann mit schnelltrocknender Acrylfarbe zu arbeiten, um das Tempo zu erhöhen. Ault, der die Auftragsliste verwaltete, schlug vor, die Preise zu erhöhen. 1973 konnte er bereits drei Bilder um je 500 USD verkaufen. Zur weiteren Steigerung des Tempos fertigte Barks Duplikate bzw. Abwandlung bestehender Konzepte an. Da der [[Geldspeicher]] ein beliebtes Motiv war, verlegte er den Schauplatz des Öfteren in den Geldspeicher und baute Details wie Kronen oder Edelsteine aus den ''National-Geographic''-Ausgaben ein. Durch die steigenden Preise kamen eher Käufer mit Geld aber ohne Kenntnisse und weniger Comicliebhaber zum Zug. 1974 wurde ein Bild bereits um 4100 USD versteigert. 1976 erzielte das Bild anlässlich des 4. Juli – der amerikanische Unabhängigkeitstag – 6400 USD. Im selben Jahr verkaufte jemand Drucke eines Bildes auf einer Convention. Als Barks das dem [[The Walt Disney Company|Disney-Konzern]] meldete, wurde die Lizenz widerrufen. George Sherman, der für ihn einige Jahre zuvor die Lizenz ermöglicht hatte, war bereits verstorben. Barks malte nun ohne Disney-Bezug weiter.<ref>Blum, G. (2012). Carl Barks – Die Ölgemälde. (G. Syllwasschy, Übers.) Köln: EGMONT Verlagsgesellschaft mbH. S. 14–22.</ref> | Barks erhielt die kostenlose Lizenz Ölbilder zu malen, unter der Bedingung, dass die Werke künstlerischen Wert haben würden und nicht günstiger als für 25 USD angeboten werden, dazu musste „© Walt Disney Productions“ auf die Vorderseite des Bildes. Carl Barks durfte die Bilder mit eigenem Namen signieren, Bleistift- und Tuschezeichnungen waren hier aber nicht inkludiert. Die Lizenz galt bis Ende des Jahres bzw. bis auf Widerruf. Er war mit Aufträgen und anderen Projekten so eingedeckt (z.B. [[Comic-Skript|Skripte]] für das [[Fähnlein Fieselschweif]]), dass er begann mit schnelltrocknender Acrylfarbe zu arbeiten, um das Tempo zu erhöhen. Ault, der die Auftragsliste verwaltete, schlug vor, die Preise zu erhöhen. 1973 konnte er bereits drei Bilder um je 500 USD verkaufen. Zur weiteren Steigerung des Tempos fertigte Barks Duplikate bzw. Abwandlung bestehender Konzepte an. Da der [[Geldspeicher]] ein beliebtes Motiv war, verlegte er den Schauplatz des Öfteren in den Geldspeicher und baute Details wie Kronen oder Edelsteine aus den ''National-Geographic''-Ausgaben ein. Durch die steigenden Preise kamen eher Käufer mit Geld aber ohne Kenntnisse und weniger Comicliebhaber zum Zug. 1974 wurde ein Bild bereits um 4100 USD versteigert. 1976 erzielte das Bild anlässlich des 4. Juli – der amerikanische Unabhängigkeitstag – 6400 USD. Im selben Jahr verkaufte jemand Drucke eines Bildes auf einer Convention. Als Barks das dem [[The Walt Disney Company|Disney-Konzern]] meldete, wurde die Lizenz widerrufen. George Sherman, der für ihn einige Jahre zuvor die Lizenz ermöglicht hatte, war bereits verstorben. Barks malte nun ohne Disney-Bezug weiter.<ref>Blum, G. (2012). Carl Barks – Die Ölgemälde. (G. Syllwasschy, Übers.) Köln: EGMONT Verlagsgesellschaft mbH. S. 14–22.</ref> | ||
[[Datei:Return to plain awful paint.JPG|thumb|250px| | [[Datei:Return to plain awful paint.JPG|thumb|250px|rechts|''Return to Plain Awful'' (© Disney)]] | ||
Die Herausgeber des größten Comickataloges, Cochran und Hamilton, versammelten eine Gruppe Händler und wandten sich an den Konzern mit der Idee, alle Bilder in einem Buch herauszubringen. Disney erlaubte das Projekt, um so die Einzelrechte der Bilder zu erlangen und so wurde 1981 im ''[[Another Rainbow|Another-Rainbow-Publishing]]''-Verlag ein Buch namens ''The Fine Art of Walt Disney's Donald Duck by Carl Barks'' mit den Gemälden von Carl Barks herausgegeben. Hamilton und Cochran suchten die Fanszene auf, um Druckvorlagen für die Duck-Gemälde zu sammeln. Das Buch enthielt aber nicht alle Bilder, da bei einigen die Qualität nicht ausreichend war. Ein Vorabexemplar des Buches erhielt einen Preis und das imponierte dem Konzern so sehr, dass sie ab 1981 eine Lizenz für eine weitere Reihe von Duck-Gemälden und limitierten Lithografien erteilten. Das Buch ''The Fine Art of Walt Disney's Donald Duck by Carl Barks'' war auf 1875 Stück limitiet, kostete damals 200 US-Dollar und war wahlweise in einer blauen oder roten [[Cover]]farbe erhältlich.<ref name="hightlightzone">[[Wolfgang J. Fuchs]]: [http://comic.highlightzone.de/tag/the-fine-art-of-walt-disneys-donald-duck-by-carl-barks/ Carl Barks – Die Ölgemälde], hightlightzone.de, abgerufen am 30.12.2021</ref> Einst die gefragten und teuren Ölgemälde von Carl Barks zusammentragend, ist das Buch inzwischen selbst zum gefragten und teuren Sammlerstück geworden. So wird es heutzutage oftmals für Preise über der 1000-Euro-Schwelle gehandelt, bis hin zu Höchstpreisen von 1800 Euro. | Die Herausgeber des größten Comickataloges, Cochran und Hamilton, versammelten eine Gruppe Händler und wandten sich an den Konzern mit der Idee, alle Bilder in einem Buch herauszubringen. Disney erlaubte das Projekt, um so die Einzelrechte der Bilder zu erlangen und so wurde 1981 im ''[[Another Rainbow|Another-Rainbow-Publishing]]''-Verlag ein Buch namens ''The Fine Art of Walt Disney's Donald Duck by Carl Barks'' mit den Gemälden von Carl Barks herausgegeben. Hamilton und Cochran suchten die Fanszene auf, um Druckvorlagen für die Duck-Gemälde zu sammeln. Das Buch enthielt aber nicht alle Bilder, da bei einigen die Qualität nicht ausreichend war. Ein Vorabexemplar des Buches erhielt einen Preis und das imponierte dem Konzern so sehr, dass sie ab 1981 eine Lizenz für eine weitere Reihe von Duck-Gemälden und limitierten Lithografien erteilten. Das Buch ''The Fine Art of Walt Disney's Donald Duck by Carl Barks'' war auf 1875 Stück limitiet, kostete damals 200 US-Dollar und war wahlweise in einer blauen oder roten [[Cover]]farbe erhältlich.<ref name="hightlightzone">[[Wolfgang J. Fuchs]]: [http://comic.highlightzone.de/tag/the-fine-art-of-walt-disneys-donald-duck-by-carl-barks/ Carl Barks – Die Ölgemälde], hightlightzone.de, abgerufen am 30.12.2021</ref> Einst die gefragten und teuren Ölgemälde von Carl Barks zusammentragend, ist das Buch inzwischen selbst zum gefragten und teuren Sammlerstück geworden. So wird es heutzutage oftmals für Preise über der 1000-Euro-Schwelle gehandelt, bis hin zu Höchstpreisen von 1800 Euro. | ||
Dagobert wurde nun in viele Gemälde eingefügt, auch wenn er nicht Teil der Handlung der ursprünglichen Geschichte war, da die Figur auf den Bildern äußerst populär war und diese höhere Preise erzielte. So wurde der Fanzeichner [[Don Rosa]] von Hamilton [[Zurück ins Land der viereckigen Eier|mit einer Fortsetzung]] zu ''[[Im Land der viereckigen Eier]] ''beauftragt, um die Abbildung von Dagobert zu erklären. Hamilton beeinflusste Barks nun immer mehr und verlangte Konzeptskizzen. Ganz glücklich war Barks nicht mit den Vorgaben, doch er lernte schon früh, die Vorstellungen der Redakteure umzusetzen und so arbeitete er ganze zehn Jahre für ''Another Rainbow Publishing'' und war auch an der Gestaltung teurer Porzellanfiguren beteiligt. Nachdem Barks Frau Garé verstorben war, lenkten zwei Manager ihn in andere Richtungen und so brach die Beziehung zu Hamilton auseinander (Verweis auf ''[[Carl Barks Collection]]'' Band 30). Barks gründete nun das ''[[Carl Barks Studio]]'' und begann, Serigrafien sowie Bronzestatuen auf Veranstaltungen in Disney-Themenparks zu verkaufen. 1994 folgte eine Europatournee und er verteilte an die beherbergenden Verlage Bilder. So kam der Künstler auf Buntstifte zurück, die nicht viel Platz im Gepäck benötigten und mit dem man schnell arbeiten konnte. Nach der Rückkehr wurden Aquarellbuntstifte die bevorzugte Wahl von Barks. Der Künstler klagte bei Ault die letzten Jahre über zittrige Hände und nachlassende Sehstärke. Anlässlich zum 96. Geburtstag des Künstlers planten die Manager eine Gala mit einer ganzen Galerie voller Kunstwerke von Barks, um die Bilder und ein weiteres Buch mit den Bildern verkaufen zu können. In den Jahren 1996 und 1997 zeichnete Barks 80 Zeichnungen mit Buntstiften. <ref>Blum, G. (2012). Carl Barks – Die Ölgemälde. (G. Syllwasschy, Übers.) Köln: EGMONT Verlagsgesellschaft mbH. S. 23–28</ref> | Dagobert wurde nun in viele Gemälde eingefügt, auch wenn er nicht Teil der Handlung der ursprünglichen Geschichte war, da die Figur auf den Bildern äußerst populär war und diese höhere Preise erzielte. So wurde der Fanzeichner [[Don Rosa]] von Hamilton [[Zurück ins Land der viereckigen Eier|mit einer Fortsetzung]] zu ''[[Im Land der viereckigen Eier]] ''beauftragt, um die Abbildung von Dagobert zu erklären. Hamilton beeinflusste Barks nun immer mehr und verlangte Konzeptskizzen. Ganz glücklich war Barks nicht mit den Vorgaben, doch er lernte schon früh, die Vorstellungen der Redakteure umzusetzen und so arbeitete er ganze zehn Jahre für ''Another Rainbow Publishing'' und war auch an der Gestaltung teurer Porzellanfiguren beteiligt. Nachdem Barks Frau Garé verstorben war, lenkten zwei Manager ihn in andere Richtungen und so brach die Beziehung zu Hamilton auseinander (Verweis auf ''[[Carl Barks Collection]]'' Band 30). Barks gründete nun das ''[[Carl Barks Studio]]'' und begann, Serigrafien sowie Bronzestatuen auf Veranstaltungen in Disney-Themenparks zu verkaufen. 1994 folgte eine Europatournee und er verteilte an die beherbergenden Verlage Bilder. So kam der Künstler auf Buntstifte zurück, die nicht viel Platz im Gepäck benötigten und mit dem man schnell arbeiten konnte. Nach der Rückkehr wurden Aquarellbuntstifte die bevorzugte Wahl von Barks. Der Künstler klagte bei Ault die letzten Jahre über zittrige Hände und nachlassende Sehstärke. Anlässlich zum 96. Geburtstag des Künstlers planten die Manager eine Gala mit einer ganzen Galerie voller Kunstwerke von Barks, um die Bilder und ein weiteres Buch mit den Bildern verkaufen zu können. In den Jahren 1996 und 1997 zeichnete Barks 80 Zeichnungen mit Buntstiften. <ref>Blum, G. (2012). Carl Barks – Die Ölgemälde. (G. Syllwasschy, Übers.) Köln: EGMONT Verlagsgesellschaft mbH. S. 23–28</ref> | ||
| Zeile 297: | Zeile 295: | ||
*1983 wurde ein einige Jahre zuvor entdeckter Asteroid nach Barks benannt: [[2730 Barks]] | *1983 wurde ein einige Jahre zuvor entdeckter Asteroid nach Barks benannt: [[2730 Barks]] | ||
*2004 veröffentlichte Reinhard Mey den Song [[Sven (Song)|Sven]] auf seinem Album ''Nanga Parbat'', in welchem er die Comics des Großmeisters ehrt | *2004 veröffentlichte Reinhard Mey den Song [[Sven (Song)|Sven]] auf seinem Album ''Nanga Parbat'', in welchem er die Comics des Großmeisters ehrt | ||
*Die niederländische Stadt Almere benannte eine Straße nach Barks („Carl Barksweg“) | |||
Es gibt zahlreiche [[Hommage]]n an den Großmeister. So zeichnete zum Beispiel [[Giorgio Cavazzano]] mit ''Der Mann hinter den Ducks'' eine Hommage an Carl Barks und ließ ihn als Comicfigur auf seine Schöpfungen treffen. Ein anderes Beispiel ist das Buch ''[[Carl Barks – Der Vater der Ducks]]'', eine Hommage an sein Gesamtwerk. Oder auch [[Don Rosa]], der in jedem seiner Comics eine [[D.U.C.K.-Widmung]] versteckte – eine Widmung an Barks. Und das sind nur einige Beispiele. | Es gibt zahlreiche [[Hommage]]n an den Großmeister. So zeichnete zum Beispiel [[Giorgio Cavazzano]] mit ''Der Mann hinter den Ducks'' eine Hommage an Carl Barks und ließ ihn als Comicfigur auf seine Schöpfungen treffen. Ein anderes Beispiel ist das Buch ''[[Carl Barks – Der Vater der Ducks]]'', eine Hommage an sein Gesamtwerk. Oder auch [[Don Rosa]], der in jedem seiner Comics eine [[D.U.C.K.-Widmung]] versteckte – eine Widmung an Barks. Und das sind nur einige Beispiele. | ||
[[Datei:Uderzo-Hommage-Barks.jpeg|200px|mini|links|Asterix verbeugt sich vor Barks' berühmtester Schöpfung, Onkel Dagobert]] | [[Datei:Uderzo-Hommage-Barks.jpeg|200px|mini|links|Asterix verbeugt sich vor Barks' berühmtester Schöpfung, Onkel Dagobert]] | ||
Nach Barks' Ableben entstand ein [[Thanks, Carl!|Hommage-Band]], für den unter anderen Albert Uderzo eine Zeichnung beisteuerte, die seine Verehrung für den „duck man“ zum Ausdruck bringt. | Nach Barks' Ableben entstand ein [[Thanks, Carl!|Hommage-Band]], für den unter anderen Albert Uderzo eine Zeichnung beisteuerte, die seine Verehrung für den „duck man“ zum Ausdruck bringt. Darüber hinaus ist das Videospiel ''[[Donald Duck Quack Attack]]'', das Ende 2000 veröffentlicht wurde, Carl Barks gewidmet. | ||
Übrigens sagt Barks über sich selbst: „Manchmal denke ich, dass ich wohl etwas Besonderes gemacht habe, vielleicht sogar etwas, das beinahe Kunst war.“ | Übrigens sagt Barks über sich selbst: „Manchmal denke ich, dass ich wohl etwas Besonderes gemacht habe, vielleicht sogar etwas, das beinahe Kunst war.“ | ||
| Zeile 310: | Zeile 309: | ||
Einige Zeichner übernahmen Ideen von Barks in ihre Geschichten. Don Rosa verwendete eine ihm gegenüber in einem Brief von Barks geäußerte Idee und ließ Dagobert in ''[[Der Einsiedler am White Agony Creek]]'' auf ein gefrorenes Mammut treffen.<ref>Plünderer im Barks'schen Gehege. Briefe von Carl Barks an [[Don Rosa]]. In: [[Barks Library Special Onkel Dagobert]] 26.</ref> Barks inspirierte [[Romano Scarpa]] zu seiner Geschichte ''Im goldenen Käfig'' und gab ihm die Idee, [[Gitta Gans]] ein nach Geld duftendes Parfum verwenden zu lassen. | Einige Zeichner übernahmen Ideen von Barks in ihre Geschichten. Don Rosa verwendete eine ihm gegenüber in einem Brief von Barks geäußerte Idee und ließ Dagobert in ''[[Der Einsiedler am White Agony Creek]]'' auf ein gefrorenes Mammut treffen.<ref>Plünderer im Barks'schen Gehege. Briefe von Carl Barks an [[Don Rosa]]. In: [[Barks Library Special Onkel Dagobert]] 26.</ref> Barks inspirierte [[Romano Scarpa]] zu seiner Geschichte ''Im goldenen Käfig'' und gab ihm die Idee, [[Gitta Gans]] ein nach Geld duftendes Parfum verwenden zu lassen. | ||
[[Datei:Freier Eintritt.jpg|thumb|400px|rechts|In diesem [[Splash-Panel]] aus ''Freier Eintritt'' von [[Vicar]] wimmelt es nur so von Anspielungen auf Geschichten von Carl Barks. Wer schafft es, sie alle zu finden? (Klicken Sie auf das Bild, wenn Sie nicht mehr weiterwissen) (© Disney Hachette Presse)]] | [[Datei:Freier Eintritt.jpg|thumb|400px|rechts|In diesem [[Splash-Panel]] aus ''Freier Eintritt'' von [[Vicar]] wimmelt es nur so von Anspielungen auf Geschichten von Carl Barks. Wer schafft es, sie alle zu finden? (Klicken Sie auf das Bild, wenn Sie nicht mehr weiterwissen) (© Disney Hachette Presse)]] | ||
Doch jetzt zu den Hommagen. Erst einmal gibt es da natürlich die berühmten Fortsetzungsgeschichten von [[Don Rosa]]. Er nahm eine Vielzahl an Schauplätzen aus Barks' Geschichten auf und schickte die Figuren dorthin, um dort ein weiteres Abenteuer zu erleben. So ließ er die Orte aus dem Barks-Universum wieder aufleben. Bekanntestes Beispiel ist hier zweifellos ''[[Zurück ins Land der viereckigen Eier]]'', wo die Ducks, wer hätte es gedacht, das berühmte Land der viereckigen Eier aus ''[[Im Land der viereckigen Eier]]'' besuchen. Und er war da noch lange nicht der einzige, so zeichnete zum Beispiel [[Vicar]] eine Art Fortsetzung zu [[Wiedersehn mit Klondike]]: ''[[Pipeline-Probleme]]''. Und dann gibt es da noch die [[Anspielung]]en. Hier ist wieder Don Rosa das bekannteste Beispiel, kaum eine seiner Geschichten besitzt keine Anspielung zu einer Barks-Geschichte. Aber hier war er ganz bestimmt nicht der einzige. Ein anderes gutes Beispiel ist hier wieder einmal Vicar, der in seinen Bildern hin und wieder Objekte aus Barks-Geschichten versteckt. Und die beiden sind nur die bekanntesten. Beliebtestes Objekt der versteckten Anspielungen sind hier entweder Dagoberts Zeit am Klondike – oder wieder die berühmten viereckigen Eier. | Doch jetzt zu den Hommagen. Erst einmal gibt es da natürlich die berühmten Fortsetzungsgeschichten von [[Don Rosa]]. Er nahm eine Vielzahl an Schauplätzen aus Barks' Geschichten auf und schickte die Figuren dorthin, um dort ein weiteres Abenteuer zu erleben. So ließ er die Orte aus dem Barks-Universum wieder aufleben. Bekanntestes Beispiel ist hier zweifellos ''[[Zurück ins Land der viereckigen Eier]]'', wo die Ducks, wer hätte es gedacht, das berühmte Land der viereckigen Eier aus ''[[Im Land der viereckigen Eier]]'' besuchen. Und er war da noch lange nicht der einzige, so zeichnete zum Beispiel [[Vicar]] eine Art Fortsetzung zu [[Wiedersehn mit Klondike]]: ''[[Pipeline-Probleme]]''. Und dann gibt es da noch die [[Anspielung]]en. Hier ist wieder Don Rosa das bekannteste Beispiel, kaum eine seiner Geschichten besitzt keine Anspielung zu einer Barks-Geschichte. Aber hier war er ganz bestimmt nicht der einzige. Ein anderes gutes Beispiel ist hier wieder einmal Vicar, der in seinen Bildern hin und wieder Objekte aus Barks-Geschichten versteckt. Und die beiden sind nur die bekanntesten. Beliebtestes Objekt der versteckten Anspielungen sind hier entweder Dagoberts Zeit am Klondike – oder wieder die berühmten viereckigen Eier. | ||
| Zeile 326: | Zeile 325: | ||
Die erste ganz Barks gewidmete Reihe stellten die ''[[Die besten Geschichten mit Donald Duck – Klassik Album|DD-Klassik-Alben]]'' („Die besten Geschichten mit Donald Duck“) der Jahre 1984 bis 1999 dar. Mit der zwischen 1992 und 2004 erschienenen, insgesamt 133 Bände umfassenden Albenreihe ''[[Barks Library]]'' (ab 2010 nachgedruckt als ''[[Entenhausen-Edition]]'') erfolgte schließlich die erste Gesamtausgabe, der sich 2005 die limitierte ''[[Carl Barks Collection]]'' für die betuchteren Fans anschloss. Mittlerweile ist aber auch im ''[[Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft|DDSH]]'' fast das gesamte Barks'sche Disney-Werk veröffentlicht worden. Eine weitere, ab 2002 erschienene und mittlerweile abgeschlossene Reihe sammelte die Barks Library im Hardcoverformat, wobei jeweils mehrere Bände zusammengefasst wurden (siehe ''[[Barks Comics & Stories]]'', ''[[Barks Donald Duck]]'', ''[[Barks Onkel Dagobert]]'', ''[[Barks Fähnlein Fieselschweif]]'' und ''[[Barks Daisy & Oma Duck]]''). Seit 2019 erscheinen mit der ''[[LTB Classic Edition]]'' alle von Barks gezeichneten Comics in chronologischem Abdruck erstmals im LTB-Format. | Die erste ganz Barks gewidmete Reihe stellten die ''[[Die besten Geschichten mit Donald Duck – Klassik Album|DD-Klassik-Alben]]'' („Die besten Geschichten mit Donald Duck“) der Jahre 1984 bis 1999 dar. Mit der zwischen 1992 und 2004 erschienenen, insgesamt 133 Bände umfassenden Albenreihe ''[[Barks Library]]'' (ab 2010 nachgedruckt als ''[[Entenhausen-Edition]]'') erfolgte schließlich die erste Gesamtausgabe, der sich 2005 die limitierte ''[[Carl Barks Collection]]'' für die betuchteren Fans anschloss. Mittlerweile ist aber auch im ''[[Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft|DDSH]]'' fast das gesamte Barks'sche Disney-Werk veröffentlicht worden. Eine weitere, ab 2002 erschienene und mittlerweile abgeschlossene Reihe sammelte die Barks Library im Hardcoverformat, wobei jeweils mehrere Bände zusammengefasst wurden (siehe ''[[Barks Comics & Stories]]'', ''[[Barks Donald Duck]]'', ''[[Barks Onkel Dagobert]]'', ''[[Barks Fähnlein Fieselschweif]]'' und ''[[Barks Daisy & Oma Duck]]''). Seit 2019 erscheinen mit der ''[[LTB Classic Edition]]'' alle von Barks gezeichneten Comics in chronologischem Abdruck erstmals im LTB-Format. | ||
[[Datei:Erika Fuchs und Carl Barks Ehapa.jpg|thumb|300px|links|Carl Barks mit [[Dr. Erika Fuchs]] (© Egmont Ehapa)]] | [[Datei:Erika Fuchs und Carl Barks Ehapa.jpg|thumb|300px|links|Carl Barks mit [[Dr. Erika Fuchs]] (© Egmont Ehapa)]] | ||
Mit [[Erika Fuchs|Dr. Erika Fuchs]] fanden die Comics von Carl Barks eine kongeniale Übersetzerin ins Deutsche. Typische 1950er-Jahre-Sprüche wie „Dem Ingeniör ist nichts zu schwör“ oder das Donald-Duck-Zitat „Wo man hinschaut, nichts als Gegend“ stammen aus ihrer Feder. Ihre Sprache war weitaus differenzierter als die des US-amerikanischen Originals, bei der Barks auch viele Slang-Wörter verwendete. Fuchs, eine promovierte Kunsthistorikerin<ref>[[Klaus Bohn]]: Das Erika Fuchs Buch. Disneys deutsche Übersetzerin von Donald Duck und Micky Maus: Ein modernes Mosaik, [[Dreidreizehn]], Lüneburg 1996: S. 26.</ref>, die als Nebenfächer Archäologie und mittelalterliche Geschichte studierte<ref>[[Klaus Bohn]]: Das Erika Fuchs Buch. Disneys deutsche Übersetzerin von Donald Duck und Micky Maus: Ein modernes Mosaik, [[Dreidreizehn]], Lüneburg 1996: S. 24.</ref>, orientierte sich oft an der Sprache von Schiller und Goethe, deren Zitate sie abfremdete (bspw. „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns waschen und Gefahr“ (siehe Bild bei ''Tick, Trick und Track'')). Für ''[[Spendieren oder Schikanieren]]'' benutzte sie Shakespeares Macbeth. Erika Fuchs ging ziemlich frei mit der Vorlage um und verpflanzte Entenhausen, seine Umgebung und seine Kultur, die bei Barks typisch amerikanische Züge tragen, nach Deutschland. | Mit [[Erika Fuchs|Dr. Erika Fuchs]] fanden die Comics von Carl Barks eine kongeniale Übersetzerin ins Deutsche. Typische 1950er-Jahre-Sprüche wie „Dem Ingeniör ist nichts zu schwör“ oder das Donald-Duck-Zitat „Wo man hinschaut, nichts als Gegend“ stammen aus ihrer Feder. Ihre Sprache war weitaus differenzierter als die des US-amerikanischen Originals, bei der Barks auch viele Slang-Wörter verwendete. Fuchs, eine promovierte Kunsthistorikerin<ref>[[Klaus Bohn]]: Das Erika Fuchs Buch. Disneys deutsche Übersetzerin von Donald Duck und Micky Maus: Ein modernes Mosaik, [[Dreidreizehn]], Lüneburg 1996: S. 26.</ref>, die als Nebenfächer Archäologie und mittelalterliche Geschichte studierte<ref>[[Klaus Bohn]]: Das Erika Fuchs Buch. Disneys deutsche Übersetzerin von Donald Duck und Micky Maus: Ein modernes Mosaik, [[Dreidreizehn]], Lüneburg 1996: S. 24.</ref>, orientierte sich oft an der Sprache von Schiller und Goethe, deren Zitate sie abfremdete (bspw. „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns waschen und Gefahr“ (siehe Bild bei ''Tick, Trick und Track'')). Für ''[[Spendieren oder Schikanieren]]'' benutzte sie Shakespeares Macbeth. Erika Fuchs ging ziemlich frei mit der Vorlage um und verpflanzte Entenhausen, seine Umgebung und seine Kultur, die bei Barks typisch amerikanische Züge tragen, nach Deutschland. Ende 2022 startete [[Onkel Dagobert und Donald Duck von Carl Barks|eine weitere Hardcover-Gesamtausgabe]], die an der Barks Library von [[Fantagraphics Books]] angelehnt ist.<ref>[https://www.instagram.com/p/CcLK8S9MPTU/ Ankündigung auf Instagram]</ref> Die Reihe wurde nach zwei Ausgaben vorzeitig eingestellt. | ||
Version vom 30. April 2024, 09:57 Uhr

Carl Barks (* 27. März 1901 in der Nähe von Merrill, Oregon, † 25. August 2000 in Grants Pass, Oregon) war ein US-amerikanischer Maler, Cartoonist sowie der bekannteste Zeichner und Autor der Disney-Comics rund um die Familie Duck.
Barks begann seine Laufbahn in den Disney Studios, wo er als Drehbuchautor arbeitete und die Cartoons mitkonzipierte, die die ersten Auftritte von Tick, Trick und Track und Daisy Duck bieten sollten. Ab 1942 sattelte der vielseitige Barks auf das Medium Comic um. In den folgenden 24 Jahren bis zu seinem Ruhestand entstanden mehr als 6100 Comicseiten, die Bahnbrechendes für die Entwicklung der Disney-Comics generell leisteten. Die zum Teil noch recht einseitig gehaltenen Charaktere aus den Trickfilmen und den Zeitungsstrips von Al Taliaferro differenzierte er und fügte neue Figuren hinzu. Er entwickelte im Alleingang die Stadt Entenhausen, ihre Umgebung und ihre wichtigsten Gebäude und fügte dem Entenkosmos viele populäre Disney-Comic-Figuren hinzu. Unter anderen der geniale Erfinder Daniel Düsentrieb, der Glückspilz Gustav Gans, die Panzerknacker oder die Hexe Gundel Gaukeley entstammen seiner Feder. Seine bedeutendste Schöpfung bleibt aber der reichste Mann der Welt, Dagobert Duck, dem Barks eine eigene Biographie auf den Leib schrieb. In seinen Comics konzipierte Barks grundlegende Genres, Konflikte und Situationen, die von zahllosen weiteren Autoren und Zeichnern aufgegriffen wurden. Viele seiner Comics sind zeitlos, obwohl sie dem Zeitgeschehen verhaftet bleiben und sich teilweise wie ein Kommentar zur Weltlage der 1940er, 50er und 60er-Jahre lesen. In seinem Ruhestand begann Barks, sich mit Ölgemälden, die die bekannten Disney-Figuren präsentieren, zu beschäftigen, die heute hohe Sammlerpreise erzielen.
![]() Liste aller Comicgeschichten von Carl Barks
Liste aller Comicgeschichten von Carl Barks
Leben
Kindheit und Jugend

Carl Barks wurde am 27. März 1901 auf einem Bauernhof in der Nähe von Merrill, Oregon, als jüngerer von zwei Brüdern, geboren. Seine Eltern, William und Arminta, waren Bauern und so half Carl bereits in jungen Jahren auf der Farm. Im Jahre 1911 zog die Familie nach Santa Rosa, Kalifornien. Das war jedoch keine weise Entscheidung: Das Geschäft lief schlecht, Arminta bekam Krebs und die Familie zog zurück nach Oregon. Als seine Mutter 1916 starb, brach der 15-Jährige Carl die Schule ab und begann einen Fernkurs an der Landon School of Cartooning. Obwohl er bereits zuvor sein Interesse fürs Zeichnen entdeckt hatte, und obwohl er zweifellos genug Talent hatte, brach er sein Studium nach vier Unterrichtsstunden wieder ab und erhielt keine formelle Ausbildung. Er musste wieder auf den Feldern aushelfen, denn der Erste Weltkrieg war ausgebrochen.
Nach Ende des Krieges ging Barks, im Alter von 18 Jahren, nach San Francisco, wo er als Laufbursche in einer Druckerei seinen Lebensunterhalt verdiente. Er suchte weiterhin nach einer Anstellung als Zeichner, bewarb sich mit zahlreichen Zeichnungen, die er während seiner Freizeit anfertigte – erfolglos. Entmutigt kehrte er 1920 zu seinem Vater auf die Farm in Oregon zurück. Dort lernte er Pearl Turner kennen, die er ein Jahr später heiratete und mit der er zwei Kinder, Peggy und Dorothy, bekam. Aufgrund einer Dürre zogen sie 1923 in die Nähe von Sacramento (Kalifornien), wo er eine feste Anstellung mit festem Einkommen als Hilfsarbeiter einer Reparaturwerkstatt für Eisenbahnen bekam. Doch Barks war nicht zufrieden und zog sich immer weiter an den Zeichentisch zurück. Das missfiel seiner Frau, die beiden trennten sich 1930.
Doch nun konnte Barks immer häufiger Zeichnungen an das Humor-Blatt Calgary Eye-Opener verkaufen, unter anderem Witzzeichnungen, aber auch kurze Geschichten und Gedichte. Er kündigte bei der Eisenbahn und zog nach Minneapolis, wo der Eye-Opener seinen Verlagsort hatte. Doch er kehrte bald wieder nach Oregon zurück, denn der Erfolg blieb aus und das Magazin ging pleite. Aber in Minneapolis hatte er Clara Balken kennengelernt, die später seine zweite Frau werden sollte.
Disney

1935 bewarb er sich dann bei den Disney-Studios, die Zeichner für Schneewittchen und die sieben Zwerge, den ersten Zeichentrickfilm in Spielfilmlänge, suchten. So zog er mit Clara nach Los Angeles. Nach einer einmonatigen Ausbildung wurde er als Zwischenphasenzeichner angestellt. Nach einem halben Jahr wurde er in die Story-Abteilung versetzt, nachdem er eine kleine Szene mit einem automatischem Friseurstuhl entworfen hatte, die Walt Disney sehr gefiel. Dort arbeitete er fast ausschließlich an Donald-Filmen, manchmal war er sogar für die Story-Regie zuständig. 1938 zog er mit seiner neuen Frau Clara nach San Jacinto, wo er sich eine kleine Farm gekauft hatte.
1942 kündigte er bei den Disney-Studios und bewarb sich bei Western Publishing, der in Lizenz Comichefte mit den Figuren des Disney-Studios produzierte und bereits zuvor zwei Comics veröffentlicht hatte, bei denen Barks mitgewirkt hatte. Er wurde angenommen und arbeitete daraufhin als freier Zeichner. Später wurde er angestellt (wohl aus steuerlichen Gründen). Er blieb lange bei Western und schuf ein beeindruckendes Werk: rund 500 mehrseitige Comicgeschichten und zahlreiche Figuren, die heute aus dem Disney-Kosmos nicht mehr wegzudenken sind, wie zum Beispiel Dagobert Duck, Gustav Gans, Daniel Düsentrieb oder die Panzerknacker. Auch der Name der Stadt Entenhausen stammt von ihm.

Doch privat lief es nicht so gut. Sein Frau Clara verfiel dem Alkohol, wurde aggressiv und Barks konnte nichts tun, da der Griff zur Flasche nicht verhinderbar war. 1951 kam dann die Scheidung. Barks meinte selber: „Mir blieb nichts als zwei Decken, meiner Kleidung, meinem Zeichenbrett und den National-Geographic-Ausgaben“. Doch kurz darauf lernte er die Landschaftsmalerin Margaret Williams, kurz Garé, kennen. Die beiden heirateten 1954 und bezogen ein Haus im südkalifornischen Hemet. Seine neue Frau half ihm auch kräftig bei seiner Arbeit, sie zeichnete Hintergründe, letterte und tuschte sogar einige seiner Arbeiten.
Ab dem Jahre 1960 erreichten Barks die ersten Fanbriefe. Zuvor hatte Western Publishing seine Adresse geheim gehalten und Briefe an Barks nicht weitergeleitet, und da die Geschichten immer nur mit Walt Disney signiert waren, kannte niemand die Identität des „guten Zeichners“. Doch nun waren ein paar besonders hartnäckige Fans ihm auf die Schliche gekommen. Er setzte auch einige der Ideen, die ihm seine Fans schickten, um.
„Ruhestand“

Am 30. Juni 1966 ging Barks offiziell in den Ruhestand. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, weitere Skripte zu schreiben, die dann von anderen Zeichnern, wie Tony Strobl, verwirklicht wurden. Jetzt widmete er sich auch, wie seine Frau, der Malerei und begann ab 1971, Szenen aus seinen Geschichten mit Öl auf Leinwand zu bannen. 1976 verbot Disney ihm das, doch er hatte bereits über 120 Gemälde mit Duck-Motiven geschaffen, die heute für sechsstellige Dollar-Beträge gehandelt werden.
1991 wurde er von der Walt Disney Company mit der Disney Legends-Auszeichnung versehen.[1]
Am 9. März 1993 starb Garé. Doch Carl blieb weiter aktiv, gründete das Carl Barks Studio, wo er zum Beispiel Porzellan- und Bronze-Figuren mit Duck-Motiven entwarf. Außerdem bereiste er die Welt, was in seinem Alter (über 90 Jahre) schon bemerkenswert ist, um unter anderem die Ausstellung seiner Bilder in Kopenhagen zu besuchen, den Ehapa Verlag, Comicläden in Stuttgart sowie den Oberbürgermeister Manfred Rommel und in München Frau Dr. Erika Fuchs, die seine Comics jahrelang für die Micky Maus und das Donald Duck Sonderheft übersetzte, zu besuchen.[2] Außerdem stand er in diesen Zeiten zahlreichen Verlagen zur Seite, die seine Geschichten veröffentlichen wollten.

Doch 1999 wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert. Ein gutes Jahr später, im Juni 2000, beschloss er, seine medizinische Behandlung zu beenden und starb in der Nacht zum 25. August im Schlaf in Grants Pass, Oregon.[3][4]
- „Im Alter von 99 Jahren ist der amerikanische Comiczeichner Carl Barks gestorben. Berühmt wurde er durch Donald Duck und die anderen Figuren aus Entenhausen, die er für die Walt-Disney-Studios entworfen hatte. Dem Zeichner der weltberühmten Enten wurde in Disneyland bereits ein Denkmal gesetzt: Unter der Feder von Carl Barks wurde der liebenswerte Verlierer Donald Duck weltberühmt, obwohl er einst nur als Nebenfigur an der Seite von Micky Maus gedacht war. 6.300 Comicseiten hat Barks seit 1942 in den USA geschaffen. 1967 trennte er sich von dem Walt-Disney-Konzern. Wegen seiner zunehmenden Sehschwäche und seiner Erkrankung hatte er das Malen bereits vor einigen Jahren aufgegeben“– Tagesschau[5]
Arbeit bei den Disney Studios
→ Für eine Liste aller von Barks fertiggestellten Filme, siehe Carl Barks/Filmografie

Wie schon gesagt, arbeitete Barks als erstes in der Zeichentrickabteilung Disneys. Gekommen war er, weil Disney Zeichner für Schneewittchen und die sieben Zwerge suchte. Bei diesem Film wirkte er als Zwischenphasenzeichner mit, was heißt, dass er die etlichen kleinen Szenen zeichnete, die die Hauptszenen verbinden, damit der Film flüssig läuft. Dieser Job ist ein ziemlich niedriger und schlecht bezahlter. Der Durchbruch gelang ihm erst, als er für den Film Modern Inventions arbeitete, in dem es darum geht, dass Donald in einem Museum für moderne Erfindungen zahlreiche unliebsame Begegnungen mit besagten Erfindungen hat. Barks entwarf hier eine Szene, in der Donald in die Klauen eines mechanischen Friseurstuhls gerät. Diese Szene amüsierte Walt Disney so sehr, dass der ihn in die Abteilung für Geschichtenschreibung versetzte. Nun führte Barks oftmals bei der Story sogar die Regie. So wirkte Barks in den folgenden Jahren als Drehbuchschreiber, meist gemeinsam mit Jack Hannah, in einigen der wichtigsten Donald-Duck-Cartoons mit. Er war maßgeblich an der Entwicklung von Tick, Trick und Track (Donald's Nephews, 1938), Franz Gans (Donald's Cousin Gus, 1939) und Daisy Duck (Mr. Duck steps out, 1940) beteiligt. Diese Figuren sollte er später als Comiczeichner weiter prägen und verfeinern.

Einige Cartoons, an denen Barks mitarbeitete, zeigten Donald bei der Ausübung eines Berufs (etwa Timber, Truant Officer Donald und The Village Smithy). Den Plot der beiden letzteren Filme verwendete Barks später für seine Zehnseiter, in denen er das Genre, Donald bei der Ausübung eines Berufes zu zeigen (Meister seines Fachs), weiter ausgestaltete. Und das war bei weitem nicht das einzige Mal, dass Barks Ideen aus Filmen wiederverwendete: Im Laufe seiner Karriere benützte Barks etliche Ideen aus der Zeit in den Studios später für die Comics. So waren schon in Entwurfszeichnungen für Schneewittchen gnomenhafte Zwerge angelegt, die Ähnlichkeit mit den Gnixen (siehe unten) hatten. Einige Entwurfszeichnungen beinhalteten Indianer, verführerische weibliche Spione, Wasserschlangen, Spukschlösser, quadratische Menschen und quadratische Eier.[6] Für den letztendlich nicht produzierten Cartoon Lost Prospectors experimentierte Barks mit grenzenlosem Glück.[7] Einige witzige Elemente besonders der frühen Comics, etwa aufgeblähte, herumhüpfende Figuren, spiegelten gängige Animationsgags der Studios wider.
1942 kündigte Barks in den Disney Studios aus mehreren Gründen:
- Barks hatte schon seit seiner Kindheit Hörschäden, die ihm nun zu schaffen machten
- Er wollte nun hauptberuflicher Comiczeichner werden
- Er war mit den Kriegspropaganda-Filmen, die Disney immer mehr produzierte, nicht einverstanden
Und so wechselte er 1942 zum Comic.
Comics
→ Für eine Liste mit allen Comics von Carl Barks, siehe Liste aller Comicgeschichten von Carl Barks
→ Für eine Liste mit allen Carl Barks gewidmeten Comicausgaben, siehe Liste aller Carl Barks gewidmeten Ausgaben
Frühe Phase (ca. 1942 – 1947)


Carl Barks fing 1942 an, sich neben seiner Arbeit in den Disney-Studios auch mit dem Zeichnen von Comicgeschichten für den Western-Verlag zu beschäftigen. Sein erster gemeinsam mit Jack Hannah gezeichneter Comic – dem nur die Mitarbeit am Skript eines Pluto-Comics vorausging – war Piratengold, eine Adaption eines letztendlich abgelehnten Filmprojektes. Die Geschichte kennzeichnet sich durch spärliche Dialoge und wenig Hintergrundgestaltung und weist nur andeutungsweise auf Carl Barks spätere Begabung hin. Wie auch die ersten Zehnseiter, die für die Publikation Walt Disneys Comics and Stories entstanden – der erste war Gesundheitsgemüse – prägte Barks' Mitarbeit in den Studios seine Skripts und Zeichnungen. Die Zehnseiter, in dieser Phase Barks' wesentlichste Arbeiten, lehnten sich an Donald-Cartoons an und zeigten dementsprechend oft Wettkämpfe zwischen Donald und seinen Neffen oder Donalds berühmtes unberechenbares Temperament, das am deutlichsten in Auseinandersetzungen mit dem in dieser Phase kreierten Nachbarn Zorngiebel zum Ausdruck kam.

Lange Donald-Duck-Geschichten orientierten sich oft an den Micky-Maus-Abenteuern von Floyd Gottfredson. Barks sah sich hauptsächlich als Künstler, der witzige Ideen für siebenminütige Cartoons oder zehnseitige Comics hervorbrachte. Lange Geschichten bereiteten ihm eher Probleme.[8] Gottfredsons Micky-Maus-Comics waren tendenziell ernste Geschichten und auch Barks thematisierte in seinen Comics bedrohliche Situationen, Psychopathen, Zerstörungen, körperliche Schäden wie Donalds Erblinden in Nordische Nächte. In etlichen dieser Geschichten taucht Kater Karlo als Gegenspieler Donalds auf, was indiziert, dass Barks die Geschichte als klassischen Micky-Comic strukturierte. Vielfach waren exotische Schauplätze handlungsleitend und Donalds Charakter trat in den Hintergrund. Dies lässt sich auch über Die Sumpfgnome sagen, auch wenn die Geschichte in anderer Hinsicht einen Meilenstein in Barks' Schaffen darstellt. Erstmals erschuf er hier ein „vergessenes“ Volk, etwas, das er viele Male wiederholen sollte. Viele Besonderheiten der Gnixen verwendete Barks für weitere seiner Kreationen; Die Sumpfgnome brachte ihm Stoff für mehr als ein Jahrzehnt.
In dieser Phase zeichnete Barks auch einige Nicht-Disney-Comics (siehe weiter unten) sowie seine einzige Micky-Maus-Geschichte, Das Rätsel des roten Hutes.
Blütephase der langen Donald-Duck-Geschichten (ca. 1947 – 1952)
Die Zeit von etwa 1947 bis Ende der 1950er-Jahre lässt sich als Barks' „klassische“ Phase bezeichnen. Eine weitere Unterscheidung bietet sich an: Bis 1952 beschäftigte sich Barks vor allem mit langen Donald-Duck-Geschichten, von denen in dieser Zeit deutlich mehr als in der vorangegangenen Phase entstanden, ab 1952 gab Barks dieses Genre ab und widmete sich hauptsächlich seiner eigenen Schöpfung Dagobert Duck.

Barks' klassische Phase beginnt nach Ansicht von Geoffrey Blum[9] mit der Geschichte Der Geist der Grotte. Es spricht einiges dafür, eine neue Phase in Barks' Schaffen ab etwa diesem Zeitpunkt anzusetzen. Mit Der Geist der Grotte schuf Barks erstmals eine Geschichte, die nicht nur vom exotischen Schauplatz oder der guten Story lebte, sondern auch eine eindrucksvolle Charakterisierung der Hauptfiguren bot, inklusive eines letztendlich sympathischen Gegenspielers und der neuaufgegriffenen Thematik der Gier nach Gold. In dieser Geschichte benützte Barks zudem das erste Mal ein Splash-Panel.

Binnen weniger Monate kreierte Barks zwei seiner wichtigsten Schöpfungen: Dagobert Duck (erster Auftritt in Die Mutprobe, Dezember 1947) und Gustav Gans (erster Auftritt in Die Wette, Januar 1948). Gustav sollte bald zum Standardpersonal der kurzen Zehnseiter werden, die sich nun vermehrt dem Konfliktdreieck Donald – Gustav – Daisy widmeten, während der Konflikt zwischen Donald und seinen Neffen weitgehend in den Hintergrund gedrängt wurde. Ein weiteres Motiv für die Zehnseiter war, Donald in der Ausübung eines Berufes zu zeigen, bei der jedoch laufend Missgeschicke passierten. Bereits zuvor hatte Barks sich an diesem Genre versucht, aber jetzt entstanden Klassiker wie Die Schulschwänzer oder Kommt zur Küstenwache!, die das Pech bald zu Donalds hervorstechendster Eigenschaft machten, nachdem es zu Beginn noch das cholerische Temperament gewesen war. In ähnlicher Weise dienten die Zehnseiter dazu, Gustavs Charakter zu formen und ihm sein sagenhaftes Glück zu verleihen (wobei dafür ebenso bedeutend die lange Geschichte Segelregatta in die Südsee war). Dasselbe geschah mit Dagobert, der zunächst durch seine Habgier, später durch seinen Geiz gekennzeichnet wurde. Sein unfassbarer Reichtum vergrößerte sich in den Zehnseitern immer mehr, bis er schließlich seinen Geldspeicher bekam (Eingefrorenes Geld) und offiziell zum reichsten Mann der Welt wurde (Der reichste Mann der Welt). Nur am Rande zu erwähnen sei hier, dass auch Daniel Düsentrieb, die Panzerknacker und das Fähnlein Fieselschweif in den Zehnseitern jener Jahre das Licht der Welt erblickten, wobei Barks sie erst in den folgenden Jahren vermehrt einsetzen sollte. Die Jahre 1947 bis 1952 sind damit auch jene, in denen die wichtigsten Bewohner Entenhausens von Barks geschaffen und geformt wurden.

Das eigentliche Kennzeichen dieser Phase sind allerdings die langen Donald-Duck-Geschichten, die in großer Zahl in verhältnismäßig kurzer Zeit entstanden (es entstanden 25 solche Geschichten verglichen mit nur 9 in der vorangegangenen Phase) und von denen viele zu Barks' besten Geschichten zählen. Auf Der Geist der Grotte folgten Die Mutprobe, Das Gespenst von Duckenburgh und schließlich, im Abstand von einem Jahr Sheriff von Bullet Valley und Im Land der viereckigen Eier, eine erste Krönung seines Schaffens. Während der Sheriff eine große Charakterstudie von Donald ist, vielleicht die beste, die Barks je geschrieben hat, greift Im Land der viereckigen Eier das Thema der vergessenen Kultur wieder auf und gilt in seiner Konstruktion und Gestaltung als eine der besten Disney-Geschichten überhaupt. Zwei weitere Geschichten, Wudu-Hudu-Zauber und Vor Neugier wird gewarnt griffen nochmals das Horror-Thema der vorangegangenen Phase auf, gestalteten es aber deutlich liebevoller und witziger. Mit Gefährliches Spiel führte er Donald in die Welt der Spione ein. Barks schickte Donald nun mehrfach auf die Suche nach historischen Schätzen oder ließ ihn historische Personen treffen (Die Jagd auf das Einhorn, Im alten Kalifornien, Der Goldene Helm und Jagd nach der Roten Magenta). In dieser Phase entstanden Barks' beste Weihnachtsgeschichten, die oft den Konflikt zwischen Donald und seinem geizigen Onkel herausstrichen (erwähnenswert sind hier vor allem Zu viele Weihnachtsmänner und Weihnachten für Kummersdorf). In Zu viele Weihnachtsmänner experimentierte Barks erstmals mit der Panelgestaltung (siehe Abschnitt zum Stil), eine Technik, die er auch auf Familie Duck auf Ferienfahrt und Die Jagd nach der Brosche anwenden sollte. Den Reigen an langen Donald-Duck-Geschichten dieser Phase beendet Barks mit Spendieren oder Schikanieren und schließt gewissermaßen den Kreis zu Die Mutprobe, die am Anfang dieser Phase stand: Nunmehr soll Donald zum Halloween-Fest bekehrt werden.
Blütephase der Onkel-Dagobert-Geschichten (ca. 1952 – 1958)

Barks' wichtigste Schöpfung Dagobert war von ihm zunehmend weiter entwickelt und sympathischer gestaltet worden. Die Figur kam bei den Lesern auch immer besser an, weswegen Western Publishing beschloss, ihr eine eigene Heftreihe zu geben, „Uncle Scrooge“. Barks bekam den Auftrag, fortan und bis zu seinem Ruhestand die Hefte fast im Alleingang zu gestalten; nur gelegentlich wirkten andere Autoren und Zeichner mit. Die erste Geschichte, die Barks für das neue Heft schrieb, war Der arme reiche Mann, das in vielerlei Hinsicht einen erneuten Meilenstein in Barks' Schaffen markierte. Die Geschichte diente als große Charakterstudie Dagoberts und zeigte ihn als schrulligen, bisweilen geizigen, aber äußerst liebenswerten alten Mann. Nachdem Barks sich bislang weitgehend über die Herkunft von Dagoberts Vermögen ausgeschwiegen hatte (in den wenigen Fällen hatte er ihn als skrupellosen Räuber oder als vom Glück Begünstigten dargestellt), schrieb er ihm mit dieser Geschichte gewissermaßen eine Biographie auf den Leib und legte fest, dass er sein Vermögen am Klondike gemacht hatte. Die Geschichte gibt auch erstmals den Panzerknackern eine tragendere Rolle und etabliert sie als Dagoberts Hauptgegner.

Auf Der arme reiche Mann folgte Wiedersehn mit Klondike, in der Barks ausführlicher auf Dagoberts Vergangenheit als Goldgräber einging und ihn – in einer zensierten vierseitigen Rückblende – als jungen Helden zeigte, der zahllose Schurken auf einmal erledigen konnte. Genau wie die folgende lange Dagobert-Geschichte 13 Trillionen machte Wiedersehn mit Klondike deutlich, wer Dagobert jetzt war und zeigte gut seine weichen Seiten. Dagobert hatte sich vom Antagonisten Donalds zum wahren Helden gewandelt, der weder Nelly ins Armenhaus gehen noch seinen Gegner Schmu Schubiack ertrinken ließ.[10]
Mit Der verlorene Zehner ließ Barks Dagobert erstmals einen mythischen Ort finden, Atlantis. Der Geschichte folgten Der verhängnisvolle Kronenkork und Die sieben Städte von Cibola. Allmählich wurde die Schatzsuche zum wichtigsten Thema der langen Dagobert-Geschichten, auch wenn sie immer wieder durch Geschichten unterbrochen wurden, in denen Barks Dagobert sein Vermögen gegen die Panzerknacker verteidigen ließ. 1956 trat als weiterer Gegner Mac Moneysac hinzu (in Der zweitreichste Mann der Welt), den Barks jedoch nur für drei Geschichten verwendete. Die Schatzsuchen stellen allerdings die Höhepunkte dieser Phase dar. Barks schickte Dagobert auf die Suche nach dem Stein der Weisen, dem Goldenen Vlies, der Krone des Dschingis Khan, den Minen König Salomos und 1959 schließlich den Schätzen der Inkas und dem Fliegenden Holländer. Kennzeichnend für die Geschichten war, dass Dagobert seine Expeditionen begann, um einen Schatz zu finden und noch reicher zu werden, obwohl ihm dies in den wenigsten Fällen gelang. Ein weiteres Genre, das Barks nun auch für Dagobert-Duck-Geschichten fruchtbar machte, war die Entdeckung eines „vergessenen“ Volkes. In zwei von Barks eindrucksvollsten Geschichten brachte er die Ducks mit Zwergindianern in Kontakt (Im Lande der Zwergindianer) und ließ sie auf die Kullern treffen (Land unter der Erdkruste).
Von den kleineren Geschichten, die die Uncle-Scrooge-Hefte füllten, sind diejenigen mit Daniel Düsentrieb erwähnenswert, da sie mithalfen, den Erfinder ebenfalls zur beliebten Comicfigur zu machen (Barks setzte Daniel nur einmal in einer langen Geschichte und selten in Zehnseitern ein). Für Katzenjammer bekam der Ingenieur sein Helferlein zur Seite gestellt, wobei auch dessen Charakter erst mit der Zeit geformt wurde.
In den Zehnseitern jener Jahre schuf Barks keine neuen Figuren oder erprobte neue Themen, sondern setzte die Konfliktlinien zwischen den wichtigsten Mitgliedern des Duck-Clans in immer neuen Variationen um. Zunehmend griff er auch früher verwendete Ideen neu auf, gestaltete diese um. Das Thema von Donalds unzähligen Jobs war eines der prägendsten und gelangte in diesem Zeitraum zur absoluten Blüte, wofür Geschichten wie Selbst ist der Mann und Ein kleines Missgeschick beredtes Zeugnis ablegen.
Späte Phase (ca. 1958 – 1967)
Gegen Ende der 1950er-Jahre nahm Western einen immer stärkeren Einfluss auf die Gestaltung der Comics und zwang Barks zu einem weitgehend vorgefertigten Raster. Halbseitige Splash-Panels, wenn sie überhaupt noch vorhanden waren, wurden zahmer (der Vergleich der sich zerstörenden Maschinen in Hans Hackebeil mit Zu viele Weihnachtsmänner bietet sich an), avantgardistische Panelgestaltung wie noch in Die Jagd nach der Brosche fehlte komplett. In vielen der langen Abenteuergeschichten lässt sich nun eine zunehmende Ernüchterung erkennen: Zwar gibt es immer noch Schatzsuchen, diese sollen nun allerdings Dagobert die Aufnahme in einen bestimmten Club ermöglichen (Die Spitzen der Gesellschaft und Die Krone der Mayas) und dienen nicht mehr zur Bereicherung. In der Geschichte Der Schatz des Marco Polo kommt der titelgebende Schatz kaum vor. Weitere lange Geschichten dieser Phase transportierten wehmütige Gefühle gegenüber längst vergangenen Zeiten, zum Beispiel Das Geheimnis der Eisenbahnaktien oder Alaska-Katastrophe. Barks wurde nun zunehmend besorgter über die vermehrten Unruhen und thematisierte öfters Krieg und Zerstörung. „Langsam gehen mir die Nationen aus, in denen keine Unruhen herrschen, Aufstände stattfinden oder Aggressionen gegen andere Nationen durchgeführt werden“, schrieb er an einen Fan.[11]

Barks etablierte nun zwei neue Thematiken für die langen Abenteuergeschichten. Zunächst entstanden, ab 1958, Geschichten über Ereignisse im Weltraum. Verlorenes Mondgold und Die Insel im All begründeten dieses Genre, stellten zugleich auch die besten Weltraumgeschichten von Barks dar. Die zweite Thematik konzentrierte sich auf die in dieser Phase neu geschaffene Gundel Gaukeley (erster Auftritt: Der Midas-Effekt), mit der zwischen 1961 und 1964 sieben lange Geschichten und zwei Zehnseiter entstanden.
Die Zehnseiter griffen nun immer häufiger auf bereits vorhandene Geschichten zurück, die Barks umarbeitete, bzw. auf immer neue Adaptionen der bekannten Motive und Konflikte. Zu Beginn der 1960er-Jahre entstanden allerdings vermehrt Zehnseiter mit dem Fähnlein Fieselschweif und ihrem Hund Spurobold. Als Antagonist dieser Geschichten diente meist Donald. In Barks' letztem Zehnseiter, Der Fluch des Albatros, gab er Daisy und Gustav ein neues Aussehen, das sich allerdings nie durchsetzte.
1959 und 1960 illustrierte Barks etliche Geschichten von Vic Lockman und Bob Gregory mit Daisy und Oma Duck in den Hauptrollen. Erwähnenswerter sind allerdings die meist achtseitigen Daniel-Düsentrieb-Geschichten jener Jahre, die Barks für eigene Four Color-Hefte schrieb.

Barks im Ruhestand
Obwohl Barks ab 1967 im Ruhestand war, wollte Western Publishing nicht auf Geschichten des „good artist“ verzichten. Barks skizzierte nun einige Donald- und Dagobert-Geschichten, die meist von Tony Strobl umgesetzt wurden und ab 1970 etliche längere Geschichten mit dem Fähnlein Fieselschweif, für die erst Tony Strobl und dann Kay Wright die Endgestaltung übernahmen. Sämtliche dieser Comics wurden später von Daan Jippes neu gezeichnet und optisch stärker dem Barks'schen Stil angepasst. Barks lieferte auch weiterhin einige Ideen für Geschichten, bzw. wurden frühere, nicht umgesetzte Ideen von anderen Künstlern ausgeführt. So entstand eine Zusammenarbeit mit Daan Jippes, Don Rosa, William van Horn, Vicar und Romano Scarpa, um nur einige zu nennen (siehe unten).
Andere Comics
Im Laufe der Zeit zeichnete Barks auch sehr viele Comics und Cartoons, die nichts mit Disney zu tun haben. Da gibt es natürlich die Karikaturen, die er Ende der 20er für den Calgary Eye-Opener zeichnete. In diesem Magazin ging es vor allem um das animalische Denken von Frauen und um das Leben von Paaren, ethnischen Minderheiten und Alkoholikern. In dieser Zeit experimentierte Barks sehr viel und wandte sehr viele verschiedene Stile an, was aber auch damit zu erklären ist, dass er den Eindruck erwecken sollte, es würden viele Zeichner für das Magazin zeichnen, obwohl er der einzige war. Doch seine Arbeit für das Magazin endete 1935 (übrigens ging es vier Jahre später pleite). Doch aus den frühen 40ern gibt es noch andere Nicht-Disney Comics, an denen Barks beteiligt war. Ein Beispiel ist hier „Barney und Benny“, ein Bär und ein Esel, mit denen er ab 1944 insgesamt 26 Abenteuer zeichnete. Diese Comics gelten als Barks' wichtigste Erfahrung außerhalb der Disney-Comics.[12]
→ Für eine Liste mit allen Comics von Carl Barks, siehe Liste aller Comicgeschichten von Carl Barks
Duck-Universum
Carl Barks baute das Universum der Ducks aus, wie kein anderer. Er erfand unzählige Figuren, Organisationen, Gegenstände und Orte, die heute nicht mehr wegzudenken wären. Hier eine Liste all seiner Erfindungen. Einige der Figuren gab es natürlich schon, doch Barks entwickelte sie weiter und machte sie zu denen, die wir heute kennen.
 Donald ist tatsächlich eine der wenigen Figuren aus dem Universum der Ducks, die es schon gab, bevor Barks seine Arbeit in den Disney-Studios begann. Und doch war er es, der ihn zu dem machte, was er heute ist: Aus dem einfältigen Wüterich und Unglücksvogel der Cartoons und Strips wurde ein gefestigter, facettenreicher, ja menschlicher Charakter. Ein gutes Beispiel ist hier die Geschichte Der Sheriff von Bullet Valley, in der fast alle von Donalds Charakterzügen auftauchen, so verschieden sie auch sein mögen. Bei Barks war die Ente Mensch geworden und so machte er sie zu einem der bekanntesten und beliebtesten Comiccharaktere überhaupt.  Huey, Dewey, and Louie, 1938. Hier soll Barks zwar nicht der Erfinder gewesen sein, doch er soll maßgeblich an der Erfindung der drei Neffen Donalds beteiligt gewesen sein. Denn er war in der Storyabteilung des Filmes Donald's Nephews, für den die drei entwickelt wurden. Eine andere Quelle besagt jedoch, dass Taliaferro die Idee an die Studios verkauft haben soll...[13] Klar ist aber, dass Barks es war, der sie zu dem machte, was sie heute sind. Denn in den Cartoons und Strips waren sie immer nur drei ungezogene Bälger, die ihrem Onkel das Leben schwer machten. Doch Barks gab ihnen noch zusätzliche Seiten. Erwähnenswert sind hier vor allem die Neffen als Fieselschweiflinge (siehe unten), die das genaue Gegenteil der alten sind: Sie sind fleißig, hilfsbereit und umweltliebend.  Gus Goose, 1939. Auch hier war Barks nicht der Erfinder, aber eben doch maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Man kann Franz jedoch keinesfalls als die glänzendste aller Barks'schen Erfindungen sehen, denn eine Figur, die nichts anderes tut, als zu schlafen und zu essen – da ist das Potenzial schnell aufgebraucht. Tatsächlich verwendete Barks die Figur in seinen Comics nur selten. Und doch bleibt Franz eine wichtige Figur, die aus dem Universum der Ducks nicht mehr herauszudenken wäre – auch wenn er meistens nur eine Nebenrolle spielt.  Daisy Duck, 1940. Und wieder eine Figur, an dessen Erfindung Barks beteiligt war: Daisy Duck, die Verlobte Donalds. Und die gehört ganz sicher zu seinen wichtigsten Erfindungen. Denn diese (für Entenaugen) verdammt hübsche Ente, die jedoch sehr viel fordert und noch dazu sehr eifersüchtig ist – was für ein Konflikt-Potenzial! Und richtig spannend wird es dann acht Jahre später, als Donald auch noch einen Konkurrenten bekommt: seinen Vetter Gustav (siehe weiter unten). Daisy ist nun eine der wichtigsten Figuren des Universums der Ducks und daraus ganz sicher nicht mehr wegzudenken. Zacharias Zorngiebel Herbert  Duckburg, 1944. In früheren Geschichten lebte Donald oft in Burbank, wo sich die Walt Disney Studios befinden. Für den Zehnseiter Auf dem hohen Seil verwendete Barks erstmals den Namen „Duckburg“, allerdings tauchte Burbank auch in seinen Werken noch bis Anfang der 50er-Jahre auf. Später baute er sie dann nach und nach immer weiter aus. Er gab ihr eine Geschichte, eine Landschaft und Umgebung, berühmte Orte und berühmte Personen.    Gladstone Gander, 1948. Wenngleich Gustav nicht Barks‘ wichtigste Schöpfung ist (den Platz nimmt unbestreitbar Dagobert ein), so ist er doch zumindest eine seiner wichtigsten. Mit diesem arroganten, faulen Glückspilz, der noch dazu in Daisy verliebt war und ihr den Hof machte, brachte Barks endlich eine Figur ins Universum der Ducks, die der Leser so richtig schön hassen konnte und die einen perfekten Gegenspieler für Donald darstellte. So gab Barks seinen Geschichten einen zusätzlichen Schub.  Junior Woodchucks of the World, 1951. Das Fähnlein ist eine weitere wichtige Erfindung. Denn so hatte Barks die Möglichkeit, Tick, Trick und Track zu eine zweite Seite zu geben: Die der hilfsbereiten, naturliebenden und wissensbewahrenden Pfadfindern, was es ihm vereinfachte, Themen wie Naturschutz in seine Geschichten einzubinden. Am Ende seiner Karriere schrieb Barks so gut wie nur noch Geschichten mit dem Fähnlein, was wohl heißt, dass er es sehr gerne hatte.  Beagle Boys, 1951. Als Dagobert regelmäßiger vorkam, bekam er auch immer mehr Geld. Was ist da das Naheliegendste? Genau! Banditen, die sich an dem Geld vergreifen wollen! Und so ließen die Panzerknacker nicht lange auf sich warten. Auch wenn sich ihr Aussehen seit ihrem Erstauftritt stark verändert hat, so bleibt doch ihre Absicht immer gleich: Sie wollen Dagoberts Geld. Und dazu lassen sie sich immer neue Sachen einfallen und sind aus dem Universum der Ducks nicht mehr wegzudenken. Für die Geschichte Die Geldquelle gab Barks den Panzerknackern ihren berühmten Opa, den Barks allerdings nur in dieser Geschichte benutzte. In Die Kohldampf-Insel erwähnte Barks erstmals das Faible eines der Panzerknacker für Pflaumen.[14]  Money Bin, 1951. Natürlich muss Dagobert sein Geld vor gefährlichen Banditen, wie die Panzerknacker es sind, schützen. Und so entstand der Geldspeicher, eine riesige Festung, in der Dagobert sein Geld aufbewahrt. Einigen Barks-Forschern zufolge soll es mehrere Speicher geben, aber der Hauptspeicher ist der mit Abstand bekannteste und ist auch heute noch in zahlreichen Geschichten zu finden. |
 Cornelius Coot, 1952. Barks baute die Stadt Entenhausen, die er erfunden hatte, im Laufe der Zeit immer weiter aus. Er gab ihr eine Umgebung, zahlreiche neue Bewohner – und vor allem gab er ihr eine Vergangenheit. In der Geschichte Der reichste Mann der Welt wurde erstmals der berühmte Gründer Entenhausens erwähnt. Barks zeigt in der Geschichte auch, wie die Statue zu Ehren Emil Erpels gebaut wurde.  Gyro Gearloose, 1952. Ebenfalls eine seiner wichtigsten Erfindungen. Auch sein Aussehen hat sich im Laufe der Zeit stark verändert, doch er ist und bleibt der geniale und leicht verrückte Erfinder, der seinen festen Platz in Entenhausen hat. Hicksi  April, May and June, 1953. Daisys Nichten, die von Barks allerdings nur selten verwendet wurden. Erst spätere Zeichner machten aus ihnen Gegner von Tick, Trick und Track und Mitglieder des ebenfalls von Barks geschaffenen Schwärmlein Kohlmeisen, das in harter Konkurrenz mit den Fieselschweiflingen steht...  Glittering Goldie, 1953. Damit Barks Dagobert sympathischer machen konnte, musste er die Leute davon abbringen zu glauben, dass der nur sein Geld liebt. Und so erfand er die schöne Nelly, den Stern des Nordens und Dagoberts Jugendschwarm…  Scrooge's First Dime (auf Deutsch auch Glückszehner), 1953. Barks deckte nach und nach immer mehr von Dagoberts Vergangenheit auf. Und so erfuhr man dann auch ziemlich schnell, dass Dagobert eigentlich arm geboren war. Über die Art, wie er dann sein Vermögen verdiente und über seine Motivation gibt es sogar bei Barks mehrere Aussagen. Doch eines ist klar: Sein erster Zehner, das erste Geld, das er eigenhändig verdiente, war dabei von entscheidender Bedeutung. Dieser Zehner enthält Dagoberts gesamte Lebenskraft; wenn er geraubt wird, ist er verloren.  The Junior Woodchucks' Guide Book, 1954. Das Schlaue Buch ist wohl eines der seltsamsten Phänomene des Duck-Universums: Ein kleines, handliches Buch, das alles Wissen der Welt enthält?! Das ist so unvorstellbar, dass Barks es noch nicht einmal versuchte, das zu erklären.[15] Dieses Wunderwerk gehört dem Fähnlein Fieselschweif und ermöglicht es ihm, alles Wissen der Welt zu bewahren und weiterzugeben. Außerdem gab Barks sich so die Möglichkeit, Dagobert besser Schätze suchen lassen zu können, denn nun konnte er von dem Wissen des Schlauen Buches unterstützt werden.  Trägt unterschiedliche Namen in verschiedenen Barks-Geschichten, erster Auftritt in Wettfahrt auf dem Mississippi, 1955, wobei es einen Vorläufer gab. Dem schweinsgesichtigen, wohlhabenden Konkurrenten Dagoberts sind keine Mittel zu schade, um seine Ziele zu erreichen. Einmal verbündet er sich sogar mit den Panzerknackern. Die Figur wurde später in etlichen Egmont-Geschichten wiederverwendet und in der Regel „Borstinger“ (engl. Angus McSwine) genannt.  Flintheart Glomgold, 1956. Dieser Schritt war eigentlich seit langem fällig und absehbar. Denn es gab eines, was Dagobert noch fehlte: Ein Konkurrent, der so viel Geld hat, dass er es mit ihm aufnehmen kann. Den schuf Barks mit Mac Moneysac, der übrigens fast Dagoberts Ebenbild ist (auch er besitzt einen Geldspeicher, scheint schottischer Herkunft zu sein und ist super geizig).  Little Helper, 1956. Eine sehr interessante Erfindung, die der Leser sofort ins Herz schließt: Dieser stumme kleine Roboter (erfunden von Daniel Düsentrieb), der aus einer Glühbirne und ein paar Drähten besteht, ist nicht nur sehr intelligent, sondern ist auch noch mit Gefühlen (seine Glühbirne leuchtet in verschiedenen Stärken) ausgestattet und äußerst putzig. In den ersten Geschichten machte Helferlein sehr viel Unsinn, doch allmählich wurde es zu Daniels Freund, Helfer, sogar Lebensretter und war dem Erfinder moralisch überlegen. Spurobold  J. D. Rockerduck, 1961. Und noch ein Konkurrent für Dagobert! Barks selbst benutzte ihn zwar nur ein einziges Mal, doch interessanterweise wurde er in italienischen Comics deutlich beliebter als Moneysac und ist heute auch nicht mehr aus dem Universum der Ducks wegzudenken.  Magica de Spell, 1961. Und noch eine Gegnerin für Dagobert! Allerdings ist sie diesmal ganz anderer Art, als die anderen: In der Tat handelt es sich bei Gundel um eine Zauberin, die um alles in der Welt Dagoberts Glückszehner haben will, da sie mit dessen Kraft dank schwarzer Magie zur reichsten Frau der Welt werden kann. Eine sehr interessante Idee, die andere Autoren natürlich schnell überzeugte – heute ist Gundel ein Dauergast bei Dagoberts Geldspeicher. Das Besondere an ihr ist auch, dass sie nicht hässlich ist, sondern geheimnisvoll und verführerisch wirkt. Rita Rührig  Grand Mogul, 1971. Diese Figur wurde tatsächlich nie wirklich von Barks gezeichnet, da er sie erst erfand, als er eigentlich schon im Ruhestand war – doch wie gesagt handelte es sich bei ihm nicht um einen wirklichen Ruhestand, denn er ersann weitere Geschichten und erfand dafür eben den Oberstwaldmeister, einen hochrangigen Fähnleinführer des Fähnleins. Vorfahren |
Natürlich wurden nicht alle Barkschen Erfindungen so durchschlagende Erfolge, wie diese. Es gibt einige von Barks verwendete Verwandte der Ducks, wie zum Beispiel Wastel Duck oder Willibald Wasserhuhn, die selten oder nie von anderen verwendet wurden.
Stil
Zeichnungen

Barks prägte die Gestaltung und den Stil der Duck-Comics wie kein anderer. Am Anfang seines Schaffens orientierte er sich stark an den Cartoons, ging jedoch Mitte der 1940er-Jahre dazu über, die Figuren weicher zu zeichnen und weniger auf übertriebene Gesten zu setzen (diese Entwicklung kann man auf dem Bild sehr gut beobachten). Während seine ersten Geschichten sich durch karge Hintergrundgestaltung auszeichneten, wurden die Hintergründe mit der Zeit detaillierter. In seiner klassischen Phase fügte Barks im Hintergrund oft witzige Portraits ein – ein Stilmittel, das andere Zeichner wie Don Rosa übernahmen – oder ließ Figuren mit kuriosen Erfindungen auftreten. Daniel Düsentrieb ist dafür das beste Beispiel, der in der ersten Geschichte als Hintergrundfigur diente, doch es gab auch Vorläufer. In der Spätphase wurden die Zeichnungen wieder karger und Barks' Strich weniger klar.
Seit Der Geist der Grotte verwendete Barks öfters halbseitige Splash-Panels, die er oft eindrucksvoll an Schlüsselstellen der Geschichte verwendete, etwa, um die Handlung schnell voranzutreiben (bspw. in Der Geist der Grotte) oder um ein besonderes Ambiente einzufangen (bspw. in Im Land der viereckigen Eier). In seiner klassischen Phase waren besonders die Splash-Panels sehr detailreich, ohne allerdings das Bild zu überlasten. In späteren Geschichten verloren auch die Splash-Panels etwas an Atmosphäre.

Für Eröffnungspanels benutzte Barks in etlichen langen Donald-Duck-Geschichten, besonders der frühen, aber auch der klassischen Phase, stimmungsvolle, nicht zur Geschichte selbst gehörende viertelseitige Panels, mit denen er die Leser auf die exotischen Schauplätze einstimmen wollte, die er in seiner Geschichte verwendete.[16] In Sheriff von Bullet Valley ist es sogar die obere Hälfte der Titelseite, die als Eröffnungssequenz wirkt, während Barks in Vor Neugier wird gewarnt die Eröffnungssequenz wirkungsvoll in die eigentliche Geschichte übergehen lässt. In Onkel-Dagobert-Geschichten der klassischen Phase verwendete Barks meist halbseitige Panels, die Dagobert in einer alltäglichen Position, meist in seinem Geldspeicher, zeigten und so keinerlei Assoziation mit der folgenden Geschichte erlaubten. In der späten Phase griff Barks wieder auf Eröffnungsbilder zurück, die mit der Geschichte verknüpft sind und zeigte meist Ausschnitte aus dem Inhalt. Die Frage war dann stets, wie die Ducks in diese Situation gekommen waren.
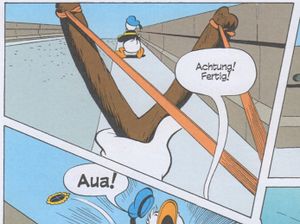
Einen besonderen Stellenwert als Eröffnungsbilder haben die ganzseitigen Panels in Zu viele Weihnachtsmänner, Rat einmal und Familie Duck auf Ferienfahrt – die drei einzigen ganzseitigen Panels in Barks' Schaffen.
In seiner klassischen Phase experimentierte Barks mit der Panelgestaltung auch innerhalb der Geschichten. Er schuf runde Panels und solche mit schrägen Rändern, die oft der Perspektive oder der Bewegung der Handelnden folgten.[17] Besonders ausgeprägt ist dieses Stilelement in Zu viele Weihnachtsmänner, Rat einmal, Familie Duck auf Ferienfahrt und Die Jagd nach der Brosche.
Geschichten
Frühe lange Geschichten von Barks thematisierten oft traumatische Erlebnisse und waren in der Erzählweise düster gehalten, nur selten durch Komik aufgelockert. Die Zehnseiter neigten zu für Disney-Comics teils übertriebenen Gewaltdarstellungen, waren aber deutlich lustiger. In Barks' klassischer Phase begannen die Grenzen zu verschwimmen. Horror-Geschichten wie Wudu-Hudu-Zauber glänzten auch durch komische Sequenzen, etwa als der Zombie Bombie einen großen Geldpreis im Radio gewann, weil er die Fragen des Moderators durch Schweigen richtig beantworten konnte. Im Gegensatz fanden sich in manchen Zehnseitern, etwa Die Zugkatastrophe, auch ernste Themen. Wurde Gewalt gezeigt, trugen die Figuren in der Regel keinen Kratzer mehr davon. Gelegentlich übersteigerte Barks die Situationskomik ins Absurde, etwa in Zu viele Weihnachtsmänner. Allgemein fällt auf, dass Barks immer stärker seine Geschichten aus den Charakteren selbst schöpfte, deren hervorstechendste Eigenschaften er konfligieren ließ. Es war kein Wunder, dass Donalds Pech und Jähzorn, Dagoberts Geiz, Gustavs Glück und Prahlerei und Daisys hohe Ansprüche nicht miteinander harmonierten und Stoff für unzählige Geschichten lieferten, die nicht nur die Zehnseiter füllten, sondern auch die langen Geschichten prägten. Viele Abenteuergeschichten entwickelten sich nun aus ganz alltäglichen Situationen. In Familie Duck auf Nordpolfahrt eskaliert etwa der Konflikt zwischen Donald und Gustav. Erst durch die von Donald gefälschte Schatzkarte, die Gustav ins Nordpolarmeer locken sollte, und Donalds anschließende Gewissensbisse kommt die Geschichte ins Rollen. In Der verlorene Zehner führt der alltägliche Konflikt zwischen Donald und Dagobert um des ersteren Bezahlung schließlich zur Entdeckung von Atlantis. Dagoberts Nerventropfen, die er braucht, weil das Geschäftsleben so stressig ist, führen fast zur Zerstörung Tralla Las (in Der verhängnisvolle Kronenkork). Barks platzierte also seine Figuren in den unterschiedlichsten Settings und zeigte, wie ihre alltäglichen Probleme eine komisch-haarsträubende Situation nach der anderen provozierten. Es gehörte daher auch oft zu den Geschichten, dass die Figuren wegen ihrer Charaktereigenschaften nicht den gewünschten Erfolg erzielten. Ein Lerneffekt stellte sich deshalb nicht ein. Wenn Dagobert in Die Geldquelle fast sein Geld an die Panzerknacker verliert, nur weil er zu geizig ist, sich einen neuen Zwicker zu kaufen, ist er in der nächsten Geschichte wieder so geizig wie eh und je.

Es gehört auch zu vielen Barks-Geschichten, dass sich die Ducks in den verfahrensten Situationen durch absurdeste Tricks retten. Es ist programmatisch, dass einer der Neffen, als Donald in Der Geist der Grotte gegen den schwertschwingenden Ritter mit einer Maus und einer Dose Mückenspray antritt, fragt: „Meinst du, der ist noch normal?“ Der andere antwortet: „Hoffentlich nicht! Ihm glückt doch immer nur was ganz Irres!“[18] Im selben Stil lässt Barks Donald Blacksnake McQuirt zu einem Jo-Jo verwandeln und Dagobert die Panzerknacker besiegen, indem er, im Unterschied zu ihnen, in seinem Geld baden kann.
Hintergründe seines Werks
Exotische Schauplätze
Barks verwendete, vor allem für seine frühen Geschichten, gerne exotische Schauplätze, um die er, wie zum Beispiel in Der Schlangenring, die Geschichte herum konstruierte. Mit der Zeit gelangte er zu einem differenzierteren Einsatz der Schauplätze und oft bestimmten die Geschichten die Orte, an denen sie spielten, und nicht umgekehrt. Um die Schauplätze realitätsnah zu geschalten, recherchierte Barks gerne in seiner umfangreichen Sammlung an „National Geographic“-Heften, aus denen er ganze Szenenbilder übernahm. Ein solcher Einfluss lässt sich stark in Der Schlangenring und in Vor Neugier wird gewarnt sehen, aber auch an einigen Eindrücken etwa in Im Land der viereckigen Eier, Piratengold oder Das Gespenst von Duckenburgh.[19][20][21]
Gesellschafts- und Zeitkritik

Barks stritt zwar jegliche politische oder gesellschaftliche Intention seiner Werke ab, trotzdem fällt es bei manchen Geschichten schwer, ebensolche zu übersehen.

Barks stand insbesondere Krieg sehr kritisch gegenüber und sah sich als Pazifist. Er lehnte auch den Kriegseintritt der USA im Zweiten Weltkrieg ab: „Als ich sah, wie wenig wir im ersten Weltkrieg erreichten, dachte ich mir, warum zum Teufel eine weitere ganze Generation junger Leute sterben lassen, nur um das gleiche Resultat zu erzielen.“[22] Einige Geschichten seiner frühen und einige der späten Phase thematisieren Gewalt, Zerstörung und Fanatismus. Am Anfang waren es besonders der Zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus, die Barks beunruhigten. In dem Zehnseiter April, April! sorgte er dafür, dass Hitlers Mein Kampf da platziert ist, wo es hingehört: auf der Müllkippe. Der Buchtitel wurde bei den ersten Veröffentlichungen in Deutschland wegretuschiert. Dieses Bild löste immer wieder Diskussionen vor allem im deutschsprachigen Raum aus, genau wie weitere Anspielungen in Originalcomics oder den Übersetzungen von Erika Fuchs.[23][24] Verweise auf den Weltkrieg finden sich z. B. auch im englischen Original der zensierten Geschichte Eine stille Nacht, in der Barks die Neffen die Eskalation zwischen Donald und seinem Nachbarn Jones mit dem Beginn eines neuen Weltkriegs vergleichen lässt.
Dem britisch-amerikanischen Comicforscher David Kunzle zufolge zeichnete Barks Zeitgeschichte, vielfach griff er brandaktuelle Themen auf und kritisierte sie.[25] Er sieht es nicht als Zufall, dass Onkel Dagobert im Original die Initialen US (für Uncle Scrooge – oder doch für United States?) trägt und sich häufig wie ein klassischer US-Imperialist und -Kapitalist verhält, der die Notlage anderer Völker schamlos ausnutzt um seine Produkte zu verkaufen, so etwa in Die Stadt der goldenen Dächer oder in Der Glockendoktor.[26] Die Kritik am Kapitalismus ist besonders in der Geschichte Weihnachten für Kummersdorf kaum zu übersehen, auf der einen Seite der reiche Dagobert, der nichts geben will, auf der anderen Seite die armen Kinder von Kummersdorf, die sich eine Spielzeugeisenbahn wünschen. Doch auch dem Kommunismus stand Barks kritisch gegenüber. Für die Geschichte Fragwürdiger Einkauf, die stark diskutiert wurde, erfand Barks Brutopien, das er später noch zweimal verwenden sollte. Hier tauchen zum Beispiel Aussagen, wie „Nieder mit allen Kapitalisten“ oder „Kanonen sind besser als Speiseeis“, auf.

Die gestiegenen Interessen der USA am Erdöl und im Nahen Osten, die sich ab der Sueskrise 1956 zeigten, beschäftigten Barks wenige Jahre später in Das große Ölgeschäft. Die größere Bedeutung des Weltraums im Wettstreit der Supermächte fing auch Barks in einigen Geschichten der 60er-Jahre ein, die sich der Weltraum-Thematik widmeten. In Die Schrecken der See thematisierte er anlässlich der Kubakrise Umsturzbewegungen in Lateinamerika (Republic of San Bananador) und ab 1966 war zunehmend der Vietnamkrieg im Fokus.[26] In Der Schatz des Marco Polo geraten die Ducks in Unstetistan in Gefechte zwischen Monarchisten und Rebellen, die durchaus die kommunistischen Aufstandsbewegungen in Asien darstellen könnten. Auch in Der Fluch des Abbadon wird der Vietnamkrieg kurz dargestellt. Es fällt allerdings auf, dass Barks weniger die Beteiligung der USA im Krieg herausstreicht, sondern sich auf den innervietnamesischen Konflikt beschränkt. Zudem ist anzumerken, dass die Kommunisten als klare Gegenspieler eines friedlichen Herrschers dargestellt werden.

In Im Lande der Zwergindianer thematisiert Barks Umweltprobleme (zu einer Zeit, da dies nur wenige andere interessierte) und das Verhältnis zu den amerikanischen Ureinwohnern, v. a. die Frage, wem das Land gehört. Neben Weihnachten für Kummersdorf ist diese Geschichte wohl eine der stärksten Kritiken des Kapitalismus. Die Umweltthematik griff Barks später in seinen Fähnlein-Fieselschweif-Geschichten wieder auf.
Öfters wurde Barks Rassismus vorgeworfen und dies an stereotypen Darstellungen von Schwarzen besonders in seinem Frühwerk festgemacht. Afrikaner werden in einigen Geschichten als Kannibalen dargestellt, sie haben große Lippen, große Nasen und spitze Zähne.[27] Am extremsten in dieser Hinsicht ist die Geschichte Der letzte Moribundus, aber auch in Wudu-Hudu-Zauber werden Schwarze stereotypisiert und Bombie, der Zombie hat dicke Lippen, eine große Nase und einen Nasenring. Stereotype Darstellungen von Schwarzen waren allerdings in den 40er-Jahren noch deutlich üblicher und es ist anzuzweifeln, dass Barks seine Geschichten bewusst rassistisch konnotierte. Den möglichen Rassismus der frühen Phase ließ Barks ab Wudu-Hudu-Zauber hinter sich; wenigen seiner späteren Geschichten kann man diesen unterstellen. Wie oben bereits angesprochen, sympathisierte Barks nun viel stärker mit anderen Kulturen.[28] Viele dieser stereotypen Darstellungen wurden in Neuauflagen retuschiert, teilweise auch durch die Übersetzung abgeschwächt.

Diese Art von Kritik sorgt dafür, dass einige Werke Barks' stark zensiert oder lange Zeit gar nicht erst veröffentlicht wurden, weil sie für einige, auch für Walt Disney, als politisch unkorrekt galten, beispielsweise Im Lande der Zwergindianer.
Über politische Kritik hinaus persifliert Barks weite Teile der Gesellschaft. So gibt er etwa Psychologen, Anwälte oder Geheimdienstler der Lächerlichkeit preis. Besonders gelungen sind seine Darstellungen der „besseren Gesellschaft“.
Verhältnis zu Medien
Barks beobachtete die Entwicklung der Massenmedien in den USA mit großem Unbehagen. Wiederholt wies er in Interviews, die er seinen Fans und Journalisten gab, auf die Gefahren des Fernsehkonsums – besonders in Formen, wie er in den USA auftritt – hin: „Bei uns [in den USA] steht der Fernsehapparat nie still, und was dann geboten wird, ist zu 99 Prozent absoluter Schund! Man kann den Einfluß des amerikanischen Fernsehns auf die Bevölkerung gar nicht genug betonen, es macht die Menschen wirklich kaputt und vergiftet sie!“[29] In einigen von Barks' Geschichten lässt sich Kritik an den Massenmedien beobachten. In Die Zugkatastrophe ist Donald vom Fernsehen völlig abgestumpft und nimmt reale Katastrophen nicht mehr als solche wahr. Einige Geschichten, beginnend mit Geld oder Ware, stellen Barks' Meinungen über groteske Quizsendungen dar, die banale Fragen stellen und dafür Leuten viel Geld geben. In Land unter der Erdkruste lässt Barks die Kullern über Geld sagen: „Bei den Quizsendungen wollen sie es immer loswerden.“ Dies drückt Barks' Sicht wohl am besten aus.
Radioaktivität
In einigen Geschichten fällt ein unbekümmertes Verhältnis zur Radioaktivität auf, das freilich für die Zeit, in der Barks schrieb und zeichnete, durchaus typisch war. Dass allerdings Donald seine Neffen mittels eines Geigerzählers finden kann, weil der Schmutz, mit dem sie gespielt haben, radioaktiv ist, hat den Donaldisten Ernst Horst dazu veranlasst, Entenhausen eine radikale radioaktive Verseuchung zu attestieren, gegen die die Enten offenbar unempfindlich sind.[30][31]
Mode
In etlichen Geschichten aus den 1960er-Jahren nahm Barks Modeerscheinungen des zeitgenössischen Amerikas auf. Er persiflierte die Hippie-Kultur, stand dieser aber zugleich skeptisch gegenüber. Modeerscheinungen lassen sich etwa gut in Eine haarige Geschichte erkennen, in der das Perückentragen zur Mode in Entenhausen wird. In Barks' letztem Zehnseiter, Der Fluch des Albatros, gab er Daisy und Gustav ein neues Aussehen und stellte insbesondere den letzteren als Vertreter der Hippie-Bewegung dar.
Ölgemälde

1955, als Barks' Arbeitslast abnahm, begann er anhand von Anleitungsbüchern sich das Malen mit Aquarellfarben selbst beizubringen. Als seine Frau zwei Jahre später einen Kurs in Landschaftsmalerei mit Ölfarben besuchte, begleitete er sie und beschäftigte sich nebenbei mit dem Medium. Außerdem experimentiere er mit Acrylfarben und fertigte Porträts kleiner Mädchen an. Anfangs hatte er Schwierigkeiten mit der Umstellung von schwarz/weiß-Bleistift und Tusche-Zeichnungen hin zu Farben. Seine ersten Motive waren die „Church of Christ Scientist“ in Hemet und vollbusige Indianerinnen. [32]

Als Katalysator für Disney-Gemälde gilt Glenn Bray, ein südkalifornischer Fan, der im Mai 1971 das erste Ölgemälde mit Donald Duck in Auftrag gab. Carl Barks hielt die Ducks in Öl für wenig erfolgversprechend. Bray bot ihm aber 150 Dollar, egal wie das Ergebnis ausfallen würde. Barks willigte ein und malte das Titelbild von Walt Disney’s Comics and Stories 108 in Öl. Während Barks an dem Bild malte, bat er George Sherman, Leiter der Publikationsabteilung bei Disney, um Erlaubnis. Diese erhielt er, als er mit dem Bild bereits fertig war, dazu bekam er auch eine Warteliste von Fans für zukünftige Gemälde. Auch wenn Bray das erste offizielle Bild erhalten hat, so hatte bereits der Dozent Donald Ault 1970 ein Bild ohne Ducks aus der Geschichte Der arme reiche Mann erhalten. [33] Barks erhielt die kostenlose Lizenz Ölbilder zu malen, unter der Bedingung, dass die Werke künstlerischen Wert haben würden und nicht günstiger als für 25 USD angeboten werden, dazu musste „© Walt Disney Productions“ auf die Vorderseite des Bildes. Carl Barks durfte die Bilder mit eigenem Namen signieren, Bleistift- und Tuschezeichnungen waren hier aber nicht inkludiert. Die Lizenz galt bis Ende des Jahres bzw. bis auf Widerruf. Er war mit Aufträgen und anderen Projekten so eingedeckt (z.B. Skripte für das Fähnlein Fieselschweif), dass er begann mit schnelltrocknender Acrylfarbe zu arbeiten, um das Tempo zu erhöhen. Ault, der die Auftragsliste verwaltete, schlug vor, die Preise zu erhöhen. 1973 konnte er bereits drei Bilder um je 500 USD verkaufen. Zur weiteren Steigerung des Tempos fertigte Barks Duplikate bzw. Abwandlung bestehender Konzepte an. Da der Geldspeicher ein beliebtes Motiv war, verlegte er den Schauplatz des Öfteren in den Geldspeicher und baute Details wie Kronen oder Edelsteine aus den National-Geographic-Ausgaben ein. Durch die steigenden Preise kamen eher Käufer mit Geld aber ohne Kenntnisse und weniger Comicliebhaber zum Zug. 1974 wurde ein Bild bereits um 4100 USD versteigert. 1976 erzielte das Bild anlässlich des 4. Juli – der amerikanische Unabhängigkeitstag – 6400 USD. Im selben Jahr verkaufte jemand Drucke eines Bildes auf einer Convention. Als Barks das dem Disney-Konzern meldete, wurde die Lizenz widerrufen. George Sherman, der für ihn einige Jahre zuvor die Lizenz ermöglicht hatte, war bereits verstorben. Barks malte nun ohne Disney-Bezug weiter.[34]

Die Herausgeber des größten Comickataloges, Cochran und Hamilton, versammelten eine Gruppe Händler und wandten sich an den Konzern mit der Idee, alle Bilder in einem Buch herauszubringen. Disney erlaubte das Projekt, um so die Einzelrechte der Bilder zu erlangen und so wurde 1981 im Another-Rainbow-Publishing-Verlag ein Buch namens The Fine Art of Walt Disney's Donald Duck by Carl Barks mit den Gemälden von Carl Barks herausgegeben. Hamilton und Cochran suchten die Fanszene auf, um Druckvorlagen für die Duck-Gemälde zu sammeln. Das Buch enthielt aber nicht alle Bilder, da bei einigen die Qualität nicht ausreichend war. Ein Vorabexemplar des Buches erhielt einen Preis und das imponierte dem Konzern so sehr, dass sie ab 1981 eine Lizenz für eine weitere Reihe von Duck-Gemälden und limitierten Lithografien erteilten. Das Buch The Fine Art of Walt Disney's Donald Duck by Carl Barks war auf 1875 Stück limitiet, kostete damals 200 US-Dollar und war wahlweise in einer blauen oder roten Coverfarbe erhältlich.[35] Einst die gefragten und teuren Ölgemälde von Carl Barks zusammentragend, ist das Buch inzwischen selbst zum gefragten und teuren Sammlerstück geworden. So wird es heutzutage oftmals für Preise über der 1000-Euro-Schwelle gehandelt, bis hin zu Höchstpreisen von 1800 Euro. Dagobert wurde nun in viele Gemälde eingefügt, auch wenn er nicht Teil der Handlung der ursprünglichen Geschichte war, da die Figur auf den Bildern äußerst populär war und diese höhere Preise erzielte. So wurde der Fanzeichner Don Rosa von Hamilton mit einer Fortsetzung zu Im Land der viereckigen Eier beauftragt, um die Abbildung von Dagobert zu erklären. Hamilton beeinflusste Barks nun immer mehr und verlangte Konzeptskizzen. Ganz glücklich war Barks nicht mit den Vorgaben, doch er lernte schon früh, die Vorstellungen der Redakteure umzusetzen und so arbeitete er ganze zehn Jahre für Another Rainbow Publishing und war auch an der Gestaltung teurer Porzellanfiguren beteiligt. Nachdem Barks Frau Garé verstorben war, lenkten zwei Manager ihn in andere Richtungen und so brach die Beziehung zu Hamilton auseinander (Verweis auf Carl Barks Collection Band 30). Barks gründete nun das Carl Barks Studio und begann, Serigrafien sowie Bronzestatuen auf Veranstaltungen in Disney-Themenparks zu verkaufen. 1994 folgte eine Europatournee und er verteilte an die beherbergenden Verlage Bilder. So kam der Künstler auf Buntstifte zurück, die nicht viel Platz im Gepäck benötigten und mit dem man schnell arbeiten konnte. Nach der Rückkehr wurden Aquarellbuntstifte die bevorzugte Wahl von Barks. Der Künstler klagte bei Ault die letzten Jahre über zittrige Hände und nachlassende Sehstärke. Anlässlich zum 96. Geburtstag des Künstlers planten die Manager eine Gala mit einer ganzen Galerie voller Kunstwerke von Barks, um die Bilder und ein weiteres Buch mit den Bildern verkaufen zu können. In den Jahren 1996 und 1997 zeichnete Barks 80 Zeichnungen mit Buntstiften. [36]
Sein letztes Ölgemälde verkaufte er 1997 an die Galerie Hans in Hamburg. Seine letzten Buntstiftzeichnungen datieren auf den August 1997. [37]
Einzelne Gemälde wurden um 200.000 USD und mehr versteigert [38]
Die Ölbilder von Carl Barks wurden auch gerne als Philatelie-Beilage im Micky-Maus-Magazin abgedruckt. Des Weiteren wurden die Gemälde auch als limitierte Lithographien (Kunstdrucke) vervielfältigt, die selbst als solche heute noch hohe Sammlerpreise erzielen.
In den 1990er-Jahren erschienen im Verlag Dreidreizehn Ölgemälde-Kalender mit den Ölgemälden von Carl Barks als Monatstitelblätter. Jedem Kalender war ein Heftchen mit Erläuterungen zu den Ölgemälden von Klaus Bohn beigefügt.
Im November 2012 erschien in der Egmont Comic Collection das Buch Carl Barks – Die Ölgemälde, herausgegeben und kommentiert von Geoffrey Blum und übersetzt von Jano Rohleder, das auf 416 Seiten alle Ölgemälde von Carl Barks sammelt und mit zahlreichen Hintergrundinformationen versehen ist. Es kostete 99 €. Das Buch greift somit die Idee des Buches The Fine Art of Walt Disney's Donald Duck by Carl Barks von 1981, in dem ebenfalls Ölgemälde von Carl Barks gesammelt abgedruckt wurden, wieder auf.[35] Ebenso wie sein Vorbild The Fine Art of Walt Disney's Donald Duck by Carl Barks ist das Buch mittlerweile zum raren und teuren Sammlerstück geworden, das oftmals zu einem Vielfachen seines Ursprungspreises gehandelt wird und oftmals in Sammlershops/Onlineshops auch vergriffen ist.
Rezeption

Carl Barks ist unbestreitbar der größte Disney-Zeichner aller Zeiten. Es gab im Laufe der Zeit weitere hochklassige Zeichner, doch dass Barks der absolute Meister ist, wagt eigentlich keiner zu bestreiten. Sogar als „den größten Comickünstler des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet ihn die Welt.[39]
Hier die von ihm gewonnen Preise:
- 1970: Shazam Award der Academy of Comic Book Arts (ACBA)
- 1973: „Hall of Fame“-Auszeichnung der ACBA
- 1977: „Inkpot“-Auszeichnung der San Diego Comic-Con
- 1985: Aufnahme in die Hall of Fame des Kirby Award
- 1987: Aufnahme in die Hall of Fame des Eisner Award[40]
- 1991: „Disney Legends“-Auszeichnung in der Kategorie „Animation & Publishing“
- 1983 wurde ein einige Jahre zuvor entdeckter Asteroid nach Barks benannt: 2730 Barks
- 2004 veröffentlichte Reinhard Mey den Song Sven auf seinem Album Nanga Parbat, in welchem er die Comics des Großmeisters ehrt
- Die niederländische Stadt Almere benannte eine Straße nach Barks („Carl Barksweg“)
Es gibt zahlreiche Hommagen an den Großmeister. So zeichnete zum Beispiel Giorgio Cavazzano mit Der Mann hinter den Ducks eine Hommage an Carl Barks und ließ ihn als Comicfigur auf seine Schöpfungen treffen. Ein anderes Beispiel ist das Buch Carl Barks – Der Vater der Ducks, eine Hommage an sein Gesamtwerk. Oder auch Don Rosa, der in jedem seiner Comics eine D.U.C.K.-Widmung versteckte – eine Widmung an Barks. Und das sind nur einige Beispiele.

Nach Barks' Ableben entstand ein Hommage-Band, für den unter anderen Albert Uderzo eine Zeichnung beisteuerte, die seine Verehrung für den „duck man“ zum Ausdruck bringt. Darüber hinaus ist das Videospiel Donald Duck Quack Attack, das Ende 2000 veröffentlicht wurde, Carl Barks gewidmet.
Übrigens sagt Barks über sich selbst: „Manchmal denke ich, dass ich wohl etwas Besonderes gemacht habe, vielleicht sogar etwas, das beinahe Kunst war.“
Barks' Geschichten bei anderen Zeichnern


Nicht nur Barks selbst, sondern auch seine Geschichten sind Objekte zahlreicher Hommagen und Anspielungen. Erst einmal muss aber gesagt werden, dass es etliche Zeichner gibt, die von Barks skizzierte Geschichten umgesetzt haben. Wie schon erwähnt, wollte Western Publishing nach Barks' Ruhestand nämlich nicht auf „den guten Zeichner“ verzichten. Und so skizzierte Barks einige Fähnlein-Fieselschweif-Geschichten, die dann von Tony Strobl und Kay Wright umgesetzt wurden. Leider war deren Stil sehr unterschiedlich von dem von Barks und auch bei den Geschichten ließen sie sich einige Freiheiten. Doch ab 1991 begann Daan Jippes, die Geschichten zu rekonstruieren und in einem verblüffend barksähnlichen Stil zu zeichnen, um so den Original-Barks-Geist bis ins kleinste Detail wiederzugeben.[41] Es gab aber auch einige Zeichner, die von Barks skizzierte oder nicht fertiggeschriebene Geschichten zeichneten, wie zum Beispiel Vicar, Don Rosa oder William van Horn. Eine besondere Bedeutung unter diesen Geschichten hat Der Rattenfänger von Entenhausen. Barks war vom Märchen des Rattenfängers fasziniert und verwendete ähnliche Ideen mehrere Male in seinen Geschichten. Für eine Four Color-Publikation mit Daniel Düsentrieb entwickelte Barks die Idee von einem Käse, der unwiderstehlich Ratten anlocken würde, skizzierte aber nur drei Seiten der Geschichte, dann brach er das Projekt ab, da ihm bewusst wurde, dass er viel zu viele Ratten hätte zeichnen müssen.[42] Don Rosa und später auch Daan Jippes stellten die Geschichte fertig, wobei zwei unterschiedliche Versionen entstanden, in denen es vor Ratten nur so wimmelte. Eine weitere erwähnenswerte Geschichte ist Geschichte und Geschichten, denn Barks entwickelte die Idee erst 1993 und schrieb den Text gemeinsam mit William van Horn, der schließlich auch die Zeichnungen übernahm.[43]
Einige Zeichner übernahmen Ideen von Barks in ihre Geschichten. Don Rosa verwendete eine ihm gegenüber in einem Brief von Barks geäußerte Idee und ließ Dagobert in Der Einsiedler am White Agony Creek auf ein gefrorenes Mammut treffen.[44] Barks inspirierte Romano Scarpa zu seiner Geschichte Im goldenen Käfig und gab ihm die Idee, Gitta Gans ein nach Geld duftendes Parfum verwenden zu lassen.

Doch jetzt zu den Hommagen. Erst einmal gibt es da natürlich die berühmten Fortsetzungsgeschichten von Don Rosa. Er nahm eine Vielzahl an Schauplätzen aus Barks' Geschichten auf und schickte die Figuren dorthin, um dort ein weiteres Abenteuer zu erleben. So ließ er die Orte aus dem Barks-Universum wieder aufleben. Bekanntestes Beispiel ist hier zweifellos Zurück ins Land der viereckigen Eier, wo die Ducks, wer hätte es gedacht, das berühmte Land der viereckigen Eier aus Im Land der viereckigen Eier besuchen. Und er war da noch lange nicht der einzige, so zeichnete zum Beispiel Vicar eine Art Fortsetzung zu Wiedersehn mit Klondike: Pipeline-Probleme. Und dann gibt es da noch die Anspielungen. Hier ist wieder Don Rosa das bekannteste Beispiel, kaum eine seiner Geschichten besitzt keine Anspielung zu einer Barks-Geschichte. Aber hier war er ganz bestimmt nicht der einzige. Ein anderes gutes Beispiel ist hier wieder einmal Vicar, der in seinen Bildern hin und wieder Objekte aus Barks-Geschichten versteckt. Und die beiden sind nur die bekanntesten. Beliebtestes Objekt der versteckten Anspielungen sind hier entweder Dagoberts Zeit am Klondike – oder wieder die berühmten viereckigen Eier.
Barks-Forschung
Barks' Werk ist unfassbar groß, vielfältig, tiefgründig. Das verlockt einige tatsächlich dazu, aus seinen Comics ein eigenes Forschungsgebiet zu machen. Bei diesen Forschungsgebieten unterscheidet man zwischen zwei Kategorien: Der Erforschung und Analyse des Textes, sowie der Forschung und Analyse des Universums.
Erstere beschäftigen sich mit dem Werk an sich. Das heißt, dass sie versuchen herauszufinden, was Barks sich bei verschiedenen Geschichten gedacht hat, was er damit sagen wollte und wie er darauf gekommen ist, wie sich sein Erzählstil geändert hat, was die verschiedenen Perioden seines Schaffens unterscheidet und noch viel mehr. Bekanntester Vertreter dieser Sparte ist zweifelsohne der amerikanische Barks-Forscher Geoffrey Blum. Nicht zu vergessen sind auch Wolfgang J. Fuchs, der erste deutsche Barks-Forscher (und wohl auch erste deutsche Comic-Forscher allgemein), der den damals noch anonym zeichnenden Barks (fälschlicherweise) als „Barx“ 1976 in seinem comicwissenschaftlichen Werk Comics – Anatomie eines Massenmediums deutschen Lesern bekannt machte, sowie Johnny A. Grote. Wolfgang J. Fuchs verfasste für Barks Comics & Stories, die Artikelreihe Entenhausener Geschichte(n) im Donald Duck Sonderheft, das DDSH Spezial, das LTB und viele andere Ehapa-Publikationen zahlreiche Forschungsbeiträge über Carl Barks.
Die zweite Art der Barks-Forschung beschäftigt sich weniger mit dem Werk an sich, sondern viel mehr mit dem Universum, das Barks schuf und unendlich ausbaute und erweiterte. Hier geht es um allgemeine und theoretische Fragen (wie zum Beispiel: In welcher Zeit spielen die Geschichten der Ducks?), aber auch um konkrete und praktische Forschungsgebiete, zum Beispiel einen exakten Stadtplan von Entenhausen anzulegen, der alle Geschichten von Carl Barks einbindet. Diese Forschung hat sogar einen eigenen Namen: Donaldismus. Der bei weitem bekannteste deutsche Vertreter dieses Forschungsgebietes ist die D.O.N.A.L.D.. Bei der D.O.N.A.L.D. ist zu beachten, dass Carl Barks und Erika Fuchs als eine Art Medium/Mittler angesehen werden, die als einzige Einblick in die Welt der Ducks haben.[45] Dubioserweise wird dabei der deutschen Übersetzung von Dr. Erika Fuchs mehr Bedeutung beigemessen als der amerikanischen Originalversion von Barks; auch Don Rosa ist bestenfalls apokryph[45] und seine Barks-Fortsetzungsgeschichten werden meist gar nicht und somit nur selten Thema wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Laut Henner Löffler fielen der recht freien Fuchsschen Übersetzung oft „Poesie und Präzision der Barksschen Texte zum Opfer“; Fuchs sei Barks daher nicht überlegen, wie es oft „eine der schwächsten Thesen des Donaldismus“ behaupte.[46] Fuchs' Texte seien anders. Entenhausen stehe in „einer anderen geographischen und sozialen Landschaft als Barks' Duckburg“.[46] Entenhausen bei Fuchs sei „weniger deutsch als Duckburg amerikanisch“, es schwebe im „luftleeren Raum einer Nichtidentität“, es sei ein „verfremdetes Amerika“, denn während das Äußere auf Amerika verweise, täten dies eben Sprache und Bezeichnungen nicht (etwa Taler statt $).[47] Bei globaler Betrachtung der Arbeit von Erika Fuchs liege „der Wert ihrer Arbeit stärker in der Bereicherung der deutschen Sprache als in einer angemessenen Übertragung des Originals“.[48]
Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum
Barks-Comics fanden sich bereits 1951 in den ersten deutschen Micky Maus-Heften der Nachkriegszeit. Das Ehapa-Flaggschiff bot im Laufe der Jahre die meisten Erstveröffentlichungen des Künstlers. Längere Barks-Abenteuergeschichten fanden ihren Platz zwischen 1951 und 1955 vornehmlich im Sonderheft der Micky Maus, später in Fortsetzungen in der MM. Ab 1965 sorgte auch das anfangs sehr Barks-lastige Donald Duck Sonderheft für Erstveröffentlichungen vieler Barks-Klassiker (neben MM-Nachdrucken in überarbeiteter oder, in seltenen Fällen, gänzlich neuer Übersetzung). Die 1979 gestartete Magazinreihe Goofy brachte regelmäßig Barks-Zehnseiter in der Rubrik „Nostalgoofy“. Auch im Lustigen Taschenbuch finden sich trotz des Barks-unüblichen Dreireiher-Formats einige wenige Geschichten (LTB 8, LTB 30, LTB 53).

Die erste ganz Barks gewidmete Reihe stellten die DD-Klassik-Alben („Die besten Geschichten mit Donald Duck“) der Jahre 1984 bis 1999 dar. Mit der zwischen 1992 und 2004 erschienenen, insgesamt 133 Bände umfassenden Albenreihe Barks Library (ab 2010 nachgedruckt als Entenhausen-Edition) erfolgte schließlich die erste Gesamtausgabe, der sich 2005 die limitierte Carl Barks Collection für die betuchteren Fans anschloss. Mittlerweile ist aber auch im DDSH fast das gesamte Barks'sche Disney-Werk veröffentlicht worden. Eine weitere, ab 2002 erschienene und mittlerweile abgeschlossene Reihe sammelte die Barks Library im Hardcoverformat, wobei jeweils mehrere Bände zusammengefasst wurden (siehe Barks Comics & Stories, Barks Donald Duck, Barks Onkel Dagobert, Barks Fähnlein Fieselschweif und Barks Daisy & Oma Duck). Seit 2019 erscheinen mit der LTB Classic Edition alle von Barks gezeichneten Comics in chronologischem Abdruck erstmals im LTB-Format.

Mit Dr. Erika Fuchs fanden die Comics von Carl Barks eine kongeniale Übersetzerin ins Deutsche. Typische 1950er-Jahre-Sprüche wie „Dem Ingeniör ist nichts zu schwör“ oder das Donald-Duck-Zitat „Wo man hinschaut, nichts als Gegend“ stammen aus ihrer Feder. Ihre Sprache war weitaus differenzierter als die des US-amerikanischen Originals, bei der Barks auch viele Slang-Wörter verwendete. Fuchs, eine promovierte Kunsthistorikerin[49], die als Nebenfächer Archäologie und mittelalterliche Geschichte studierte[50], orientierte sich oft an der Sprache von Schiller und Goethe, deren Zitate sie abfremdete (bspw. „Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns waschen und Gefahr“ (siehe Bild bei Tick, Trick und Track)). Für Spendieren oder Schikanieren benutzte sie Shakespeares Macbeth. Erika Fuchs ging ziemlich frei mit der Vorlage um und verpflanzte Entenhausen, seine Umgebung und seine Kultur, die bei Barks typisch amerikanische Züge tragen, nach Deutschland. Ende 2022 startete eine weitere Hardcover-Gesamtausgabe, die an der Barks Library von Fantagraphics Books angelehnt ist.[51] Die Reihe wurde nach zwei Ausgaben vorzeitig eingestellt.
In DDSH 260 startete 2009 die Veröffentlichung von Neuübersetzungen, die sich versuchsweise näher am Original orientieren als die Fuchs-Erstversionen.
Siehe auch
- Liste aller Comicgeschichten von Carl Barks
- Carl Barks/Filmografie
- Liste aller Carl Barks gewidmeten Ausgaben
- Barks (Begriffsklärung)
- Carl Barks Studio
- Carl Barks' Völker
- Kategorie:Carl Barks
Literatur
- Carl Barks, Dr. Erika Fuchs (Übersetzung): Carl Barks Collection, Egmont Comic Collection, Köln 2005–2008: hier sind alle Geschichten von Carl Barks mit zahlreichen Hintergrundinformationen und Analysen abgedruckt
- Uwe Anton und Ronald M. Hahn: Donald Duck – Ein Leben in Entenhausen, München 1994, ISBN 3-910079-55-5
- Johnny A. Grote: Carl Barks. Werkverzeichnis der Comics, Stuttgart 1995, ISBN 3-7704-1898-0
- Gottfried Helnwein: Wer ist Carl Barks, Bayreuth 1993
- Michael Barrier, Peter Reichelt (Übersetzung): Carl Barks. Die Biographie, Brockmann und Reichert Verlag, Mannheim 1994, ISBN 9783923801992
- Patrick Bahners: Entenhausen – Die ganze Wahrheit, C. H. Beck, München 2013 (donaldistisches Werk über den von Carl Barks geschaffenen Enten-Kosmos, bebildert mit zahlreichen Barks-Panels), ISBN 978-3-406-44802-7.
- Thomas Andrae: Carl Barks and the Disney Comic Book. Unmasking the Myth of Modernity, Jackson, MS 2006 (detaillierte englische Studie zu Leben und Hintergründen des Werkes), ISBN 1-57806-858-4
- David Kunzle: Carl Barks. Dagobert und Donald Duck. Welteroberung aus Entenperspektive, Frankfurt/Main 2002 (mit einer Analyse der politischen Hintergründe von Barks' Werk), ISBN 3-59623-949-4
- Klaus Strzyz/Andreas C. Knigge: Disney von innen. Gespäche über das Imperium der Maus. Mit einem Vorwort von Carl Barks, Ullstein Sachbuch, Frankfurt am Main/Berlin 1988, ISBN 3-548-36551-5
- Carl Barks – Der Vater der Ducks, Egmont Comic Collection, Berlin 2002, ISBN 3-7704-2792-0
- TGDDSP 9: „Comics und Bildergeschichten von Carl Barks“, Egmont Ehapa Verlag, Berlin 2007 (mit redaktionellem Teil von Wolfgang J. Fuchs), ISBN 4-196050-004504.
- TGDDSP 14: „Tierisches Entenhausen von Carl Barks“, Egmont Ehapa Verlag, Berlin 2009 (mit redaktionellem Teil von Wolfgang J. Fuchs), ISBN 4-196050-004955.
- Geoffrey Blum, Carl Barks (Abbildungen), Jano Rohleder (Übersetzung): Carl Barks – Die Ölgemälde, Egmont Comic Collection, Köln 2012, ISBN 978-3-7704-3685-9
- Henner Löffler: Wie Enten hausen – Die Ducks von A bis Z, C. H. Beck, München 2004, ISBN 3-406-51808-4
- Marcia Blitz (übersetzt ins Deutsche): Donald Duck – 50 Jahre und kein bißchen leise, Unipart, Remseck bei Stuttgart 1984 (mit Informationen zu den Comics, Comicheften, Trickfilmen und Ölgemälden von Carl Barks), ISBN 3-8122-0144-5
- Michael Czernich (Übersetzung), Lucia Czernich (Übersetzung): Donald Duck – So bin ich und so bleibe ich, Ehapa Buchverlag, München 1986 (mit Informationen zu Carl Barks als Trickfilmzeichner, story man, Comiczeichner und die von ihm erfundenen Figuren), ISBN 3-7704-0320-7
- Klaus Bohn, Monika Bohn: Das Erika Fuchs Buch. Disneys deutsche Übersetzerin von Donald Duck und Micky Maus: Ein modernes Mosaik, Dreidreizehn, Lüneburg 1996 (mit Informationen zur deutschen Übersetzung der Barks'schen Originaltexte von Erika Fuchs), ISBN 3-929746-10-7
- Ernst Horst: Nur keine Sentimentalitäten! Wie Dr. Erika Fuchs Entenhausen nach Deutschland verlegte, Blessing, München 2010 (3. Auflage) (über die Übersetzung von Erika Fuchs des Barks'schen Gesamtwerks, bebildert mit zahlreichen Barks-Panels), ISBN 978-3-8667-406-7)
- Grobian Gans: Die Ducks – Psychogramm einer Sippe, rororo, Reinbek bei Hamburg 1972 (diverse Auflagen) (mit Charakterstudien und psychologischen Untersuchungen zu den Ducks), ISBN 9-783-499-114-816
- Fabian Gross: Porträt: Carl Barks; Hintergrund: In Barks' Fußstapfen; Hintergrund: Neue alte Geschichten, in: Donald Duck – Die Anthologie (Die Ente – Die Legende), Egmont Comic Collection, Berlin 2018: S. 19; S. 144; S.301-302, ISBN 978-3-7704-3955-9.
- Peter Reichelt, Harald Havas, Wolfgang J. Fuchs: Gezeichnet Walt Disney? – Micky, Donald und ihre Väter: Carl Barks, Floyd Gottfredson und Al Taliaferro, Brockmann und Reichelt, Mannheim 2012, ISBN 978-3-9238-0158-9.
Weblinks
- HTML BarksBase, die umfangreichste Web-Datenbank zu Carl Barks
- cbarks.dk Diverse Details zu Barks' Duck-Comics (engl.)
- A Guidebook to the Carl Barks Universe Die dritte wichtige Webseite zum Thema (engl.)
- Die klassischen Duck-Abenteuer von Carl Barks
- Rezensionen von Barks-Zehnseiter im F.I.E.S.E.L.S.C.H.W.E.I.F.
- Entenhausen ist überall auf Youtube

- Carl Barks Interview (englisch) 1975 auf Youtube

- Carl Barks "the art and times Carls Barks" auf Youtube

- Carl Barks a duckomentary part 1 auf Youtube

- Carl Barks a duckomentary part 2 auf Youtube

- Carl Barks a duckomentary part 3 auf Youtube

- Carl Barks a duckomentary part 4 auf Youtube

- Carl Barks Interview (englisch) auf Youtube

- Liste der Gemälde von Carl Barks in der Wikipedia
- 27. März 1901 - Geburtstag des Comiczeichners Carl Barks, WDR Stichtag auf wdr.de, vom 27. März 2016, abgerufen am 26. Februar 2024
Einzelnachweise
- ↑ https://d23.com/walt-disney-legend/carl-barks/
- ↑ Carl Barks – Der Vater der Ducks, Egmont Comic Collection, Berlin 2002: S. 303–306.
- ↑ Carl Barks – Der Vater der Ducks, Egmont Comic Collection, Berlin 2002: S. 17.
- ↑ Carl-Barks.de über den Zeichner
- ↑ das tsarchive zitiert die Meldung der „Tagesschau“ zum Tod von Carl Barks im Wortlaut, abgerufen am 13. Mai 2021
- ↑ Geoffrey Blum: Der „klassische Barks“. Übersetzt von Johnny A. Grote. Barks Library Special Donald Duck 3, S. 33.
- ↑ Lost Prospectors. Barks Comics & Stories 2.
- ↑ Blum: Der „klassische Barks“, S. 32, 34.
- ↑ Blum: Der „klassische“ Barks.
- ↑ Vgl. für Barks Selbsteinschätzung dieser Geschichte Blum: Der „klassische“ Barks, S. 30.
- ↑ Geoffrey Blum: Einstürzende Imperien, Teil 2: Der alte Kämpfer. In: Barks Library Special Onkel Dagobert 19, S. 51.
- ↑ Carl Barks – Der Vater der Ducks, Egmont Comic Collection, Berlin 2002: S. 73.
- ↑ Carl Barks – Der Vater der Ducks, Egmont Comic Collection, Berlin 2002: S. 28.
- ↑ Anmerkung: In der deutschen Übersetzung fehlt dieser Hinweis.
- ↑ Anmerkung: Später schaffte Don Rosa es, in Auf der Suche nach der verlorenen Bibliothek zu erklären, wie es sein kann, dass es alles Wissen der Welt enthält, aber wie das auf so wenig Platz möglich sein soll, das ließ auch er offen.
- ↑ Geoffrey Blum: Erste Eindrücke. Übersetzt von Johnny A. Grote. In Barks Library Special Donald Duck 4.
- ↑ Donald Ault: Carl Barks und die Kunst der Perspektive. Übersetzt von Johnny A. Grote. In Barks Library Special Donald Duck 18.
- ↑ Vgl. Geoffrey Blum: „Der Geist der Grotte“ – wie es dazu kam und was daraus wurde. Übersetzt von Johnny A. Grote, Barks Library Special Donald Duck 7, S. 56.
- ↑ Thomas Andrae und Geoffrey Blum: Realität und Fiktion bei Carl Barks. Übersetzt von Johnny A. Grote. In Barks Library Special Donald Duck 3, 4 und 5.
- ↑ Geoffrey Blum: Faszination des alten Persien. In Barks Library Special Donald Duck 15.
- ↑ Geoffrey Blum: Ein Blick auf den Felsen. In Barks Library Special Donald Duck 15.
- ↑ Thomas Andrae (2006): Carl Barks and the Disney Comic Book (Jackson, Mississippi: Univ. Press of Mississippi) S. 57.
- ↑ Vergangenheitsreste in Entenhausen, abgerufen am 21.04.2020.
- ↑ Fauxpas in Micky Maus (Spiegel), abgerufen am 21.04.2020.
- ↑ Ente, weiß und mächtig (Spiegel), abgerufen am 21.04.2020.
- ↑ 26,0 26,1 David Kunzle: Dispossession by Ducks: The Imperialist Treasure Hunt in Southeast Asia. In: Art Journal 49/2 (1990), S. 149–162.
- ↑ Wir gegen die (Tagesspiegel), abgerufen am 21.04.2020.
- ↑ Vgl. auch Ducks and Disney: The Enduring Humanity of Carl Barks, abgerufen am 21.04.2020.
- ↑ Zitiert nach: Klaus Strzyz/Andreas C. Knigge: Disney von innen. Gespräche über das Imperium der Maus, Ullstein, Frankfurt am Main/Berlin 1988: S. 50.
- ↑ Ernst Horst: Unser Freund – das Atom. Teil 1: Die Wahrheit über Entenhausen. In: Der Hamburger Donaldist 34 (1982).
- ↑ Ernst Horst: Nur keine Sentimentalitäten! Wie Dr. Erika Fuchs Entenhausen nach Deutschland verlegte, Blessing, München 2010: S. 282–283.
- ↑ Blum, G. (2012). Carl Barks – Die Ölgemälde. (G. Syllwasschy, Übers.) Köln: EGMONT Verlagsgesellschaft mbH. S. 9–10.
- ↑ Blum, G. (2012). Carl Barks – Die Ölgemälde. (G. Syllwasschy, Übers.) Köln: EGMONT Verlagsgesellschaft mbH. S. 11–13.
- ↑ Blum, G. (2012). Carl Barks – Die Ölgemälde. (G. Syllwasschy, Übers.) Köln: EGMONT Verlagsgesellschaft mbH. S. 14–22.
- ↑ 35,0 35,1 Wolfgang J. Fuchs: Carl Barks – Die Ölgemälde, hightlightzone.de, abgerufen am 30.12.2021
- ↑ Blum, G. (2012). Carl Barks – Die Ölgemälde. (G. Syllwasschy, Übers.) Köln: EGMONT Verlagsgesellschaft mbH. S. 23–28
- ↑ Blum, G. (2012). Carl Barks – Die Ölgemälde. (G. Syllwasschy, Übers.) Köln: EGMONT Verlagsgesellschaft mbH. S. 346–347
- ↑ http://www.jenspeterkutz.de/barksgemaelde.html
- ↑ Artikel der Welt, eigentlich über Don Rosa, hier fallen aber auch einige Bemerkungen über Carl Barks
- ↑ Auflistung der Awards in der San Diego Comic-Con, abgerufen am 02.05.2020.
- ↑ Carl Barks – Der Vater der Ducks, Egmont Comic Collection, Berlin 2002: S. 280.
- ↑ Geoffrey Blum: Das Märchen vom Rattenfänger in den Comics von Carl Barks. Übersetzt von Christoph Eiden. In: Barks Library Special Daniel Düsentrieb 2.
- ↑ Wolfgang J. Fuchs in: DDSH 340: Entenhausener Geschichte(n), Folge 234: DDSH – Die mittleren Jahre und William Van Horn, Egmont Ehapa Media, Berlin 2015: S. 34–35.
- ↑ Plünderer im Barks'schen Gehege. Briefe von Carl Barks an Don Rosa. In: Barks Library Special Onkel Dagobert 26.
- ↑ 45,0 45,1 Wolfgang J. Fuchs, Dr. Susanne Luber: Entenhausener Geschichte(n), Folge 284: Die Donaldisten – Ein Gespräch zwischen Wolfgang J. Fuchs und Dr. Susanne Luber, in: Die tollsten Geschichten von Donald Duck – Sonderheft 390, Egmont Ehapa Media, Berlin 2019: S. 35.
- ↑ 46,0 46,1 Henner Löffler: Wie Enten hausen – Die Ducks von A bis Z, C. H. Beck, München 2004: S. 406.
- ↑ Henner Löffler: Wie Enten hausen – Die Ducks von A bis Z, C. H. Beck, München 2004: S. 406–407.
- ↑ Henner Löffler: Wie Enten hausen – Die Ducks von A bis Z, C. H. Beck, München 2004: S. 407.
- ↑ Klaus Bohn: Das Erika Fuchs Buch. Disneys deutsche Übersetzerin von Donald Duck und Micky Maus: Ein modernes Mosaik, Dreidreizehn, Lüneburg 1996: S. 26.
- ↑ Klaus Bohn: Das Erika Fuchs Buch. Disneys deutsche Übersetzerin von Donald Duck und Micky Maus: Ein modernes Mosaik, Dreidreizehn, Lüneburg 1996: S. 24.
- ↑ Ankündigung auf Instagram
| Dieser Artikel wurde von den Mitgliedern der Duckipedia als Lesenswerter Artikel ausgezeichnet. Folge dem Link, um mehr darüber zu erfahren. |